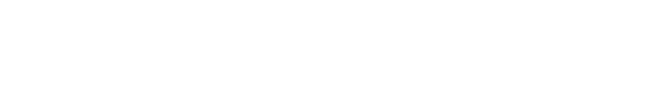Repräsentant der Zweiten Reihe
Prototyp für deutsche Sängerstandards: Alfred Färbach
Von Joseph Keilberth, einem der führenden Operndirigenten der 1930-60er Jahre, zuletzt Generalmusikdirektor der
Bayerischen Staatsoper, stammt eine Bemerkung, die zum vielzitierten Merksatz wurde: „Früher konnte jedes Stadttheater den Tristan
aus eigenem Ensemble doppelt besetzen. Heute bricht der ganze Betrieb zusammen, wenn Windgassen mal absagt.“ Die nach beiden Seiten hin natürlich überspitzte Feststellung bezog sich (nicht nur)
auf das Heldentenöre-Angebot um die Jahrhundertmitte und auf eine Situation, die sich seither eher noch verschärft hat, weil sie nun auch auf einen eklatanten Mangel an hochdramatisch-heroischen
Bassbaritonen zutrifft. Mit früher aber war die Zeit vom letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre hinein gemeint.
In diesen – opernaufführungs- & gesangskunstbezogen – Glücksjahrzehnten gab
es allerdings eine stolze Phalanx stimmlich reichbegabter, erstklassig ausgebildeter, noch in unvollkommenen Tondokumenten glanzvoller Sängerstars = Beweisgeber maßstabsetzenden Gesangs auf dem
Fundament der klassischen Schule, an denen sich heutige Weltstars messen lassen müssten. Um beim Fach des Tenore dramma- tico, also des Heldentenors, zu bleiben, seien – soweit durch Tonaufnahmen
doku- mentiert – nur ganz wenige Jahrhundertnamen genannt: Jacques Urlus, Heinrich Knote, Leo Slezak, Francisco Viñas, Ernest van Dyck, Heinrich Hensel, Karel Burrian, Alexander Kirchner, Guseppe
Borgatti, Paul Althouse und natürlich
Lauritz Melchior. Ihnen folgten auf gleicher Rangstufe Graarud, Menzinsky, Schubert, Oehman, Fagoaga, Lorenz, Völker, Suthaus, Svanholm …
Ein Zeitalter der Legenden
Die für gerade mal vier Jahrzehnte ganz erstaunliche Vielfalt solcher Sänger-besetzungen – und deren Tonspuren in den
Schallarchiven – versperrt uns heute meist den Blick auf die Breite und Fülle der Reserven dahinter. Auch wenn man Keilberths Verdikt als bewusst extreme Pointensetzung verstehen will: Einen
Wahrheitskern hatte es schon. Denn es bezog sich auf eine Ära unter dem Prinzip des Ensembletheaters mit bis in die weltweite Spitzenkategorie hinein festen Stammbesetzungen an Opernhäusern, in denen
jeder noch so ubiquitär aktive Sängerstar „seine“ Basis, sein Stammhaus hatte, an dem er meist universelles Repertoire ohne Fachbindung zu singen bekam. Im Gegensatz zu den italo-hispanischen
Operntruppen mit ihren Stagioni und Tournéen, die Bühnensolisten für Abende, maximal Wochen unter Vertrag nahmen, war die Ensemblekultur
im deutschen Sprachraum ein kulturhistorischer Faktor für Verlässlichkeit und Bestand bei der Entwicklung, Bewährung, Hochleistung und Dauer großer oder doch solider
Sängerkarrieren.
In deutschsprachigen Landen gab es 80 bis 90 feste Operntheater mit festen Ensembles – von den Hof-, später
Staatstheatern in den Kapitalen Berlin, Wien, Hamburg, Dresden, München, Wien, Prag (oft mehr als eines am Platze), bis zu mittelstädtischen Residenzen von Großherzogtümern und Grafschaften, im
ersten Jahrhundertquartal auch zunehmend bürgerschaftlich getragene Stadttheater in Regionalhauptstädten. Einige davon hatten schon seit dem 19. Jahrhundert aus- strahlenden Ruf – so Weimar,
Meiningen, Leipzig, Oldenburg, Hannover, Köln, Mainz, Stuttgart, Darmstadt, die expansiven Industriemetropolen an Rhein und Ruhr, dazu – was Wagnerpflege angeht – mit besonderem Profil Mannheim und
Karlsruhe. Die Bayreuther Festspiele zum Beispiel verpflichteten gerade aus diesen Ensembles regelmäßig erste Fachvertreter. Einige davon gastierten weltweit und blieben doch ihren Heimatbühnen treu,
nicht wenige für Jahrzehnte.
Faszination der Fülle
Nimmt man also Keilberths Sentenz kurz einmal wörtlich, dann müssten an bis
zu 100 Opernhäusern im Deutschen Reich, Österreich, Schweiz und K.K.-Ungarn/ Oberitalien an die 200 Titelrollen-Träger für die extreme Heldentenorpartie in Tristan und Isolde einsatzfähig
gewesen sein – eine gegenüber den Verfügbarkeiten seit 60-70 Jahren nahezu märchenhafte, unfassbare Zahl. Trifft sie auch nur ansatzweise zu, muss es einen weitgezogenen, übervollen Sänger-, vor
allem also Tenor-Fundus gegeben haben. Und in der Tat: Der für heutige Urteilsquellen so ergiebige Umstand, dass ausgerechnet in der frühen Acoustics-Aufnahmezeit mit Trichter und Schellackplatte ein
seither nie wiederholtes Großangebot an Tonauf-nahmen mit Sängerstimmen realisiert wurde, bringt uns auch dieser Frage näher.
Nach und neben den Diskographien weltbedeutender Stimmen auf Tonträgern finden sich in den Archiven (= den
Angebotskatalogen des frühen 20. Jahrhunderts) in Fülle auch Aufnahmen von Sängerinnen und Sängern von maximal regionaler, großstädtischer Bedeutung, die selbst Kenner heute nur noch dem Namen nach
oder gar nicht kennen. Unter diesen dominierten, wie immer schon, Tenöre. Selbst solche, die in den Annalen der großen Operninstitute als Hausbesetzung galten oder nur gelegentlich als Gäste
erscheinen, aber nie zur Ersten Reihe gehörten, oft ihr ganzes Sängerleben lang an Hof- oder Hauptstadt-Theatern eine solide Laufbahn absol-vierten. Dass sie dennoch Aufnahmen für öffentlichen
Handelsvertrieb machen konnten, erscheint uns angesichts heutiger Produktions- und Vermarktungs-
bedingungen weithin wie ein Mirakel.
Auch für dieses Kapitel der Gesangsgeschichte ein paar wenige Beispiele. Tenöre, vorrangig an Stammhäusern tätig: Robert
Hutt in Berlin. Max Hirzel in Dresden. Carl Günther in Hamburg. Willy Zilken in Leipzig. Josef Schöffel in Prag. Fritz Zohsel in Berlin und Dresden. Carl Hauss in Hannover. Wilhelm Ulmer in
Düsseldorf. Fritz Rémond in Köln. John Gläser in Frankfurt. Alois Hadwiger in Bremen … und viele mehr.
Solche Sänger kann man – immer mit Bewusstsein für schwankende Aufnahme-qualitäten und eingeschränkte Klang-Authentizität
– als Zweite Reihe bezeichnen. Einer Vielzahl von Tenören darunter kann man gute Stimmen und respektable Gesangsleistungen attestieren – jedenfalls im deutschen Repertoire und dort nicht
zuletzt im Wagner-Gesang. Bei Stücken aus dem italienisch-französisch-slawischen Bühnenrepertoire, vor allem des Canto fiorito wie des Belcanto schlechthin, sind die Eindrücke deutlich zwiespältiger,
um nicht zu sagen desaströser. Ein typischer Vertreter dieser Sänger-Kategorie war der deutsche Tenor Alfred Färbach, dessen Tondokumente diese HAfG Acoustics-CD vorstellt.
_____________________________________________________________________
Alfred Färbach (Tenor) * 1878 Stuttgart – † 1939 Mannheim.
Nach dem zuvor Gesagten kann es kaum überraschen: Über seine Herkunft, Sozialisierung, Ausbildung ist so gut wie nichts
in Erfahrung zu bringen. In den Fachlexika wird er mit dürren Hinweisen mehr aufgezählt als eingeordnet. In den Kompendien von Jürgen Kesting und Jens Malte Fischer wird er nicht erwähnt.
In den raren Chroniken der ganz großen Operninstitute – Met, Scala, Wiener Oper
– kommt er nicht vor. Man weiß gerade so viel: Seine Ausbildung vollzog sich vor- wiegend in Berlin. Er debütierte in der Spielzeit 1908-09 am Hoftheater Sondershausen (Thüringen), sang
dann 1909-10 am Stadttheater Elberfeld, 1910-12 am Stadttheater von Stettin, 1912-14 am Städtischen Theater Stadttheater in Halle (Saale), 1914-15 am Opern- haus Breslau (Wroclaw), 1915-18 am
Stadttheater von Straßburg und 1919-20 am Stadt-theater von Freiburg i.Br. Seine Karriere erreichte den Höhepunkt in den Jahren 1920-26
am Nationaltheater Mannheim.
Während und noch nach dieser Laufbahn trat Färbach häufig als Abendgast, gelegentlich auch als Rollenträger in einer
bestimmten Produktion, an großen Häusern Mitteleuropas auf. Seit Mitte der 1920er wirkte er in Mannheim als Gesangspädagoge. 1911 hatte er in Stettin an der Uraufführung der Operette Ball
bei Hof von Carl Michael Ziehrer, dem Komponisten erfolgreicher Wiener Operetten und Walzer, teilgenommen. Unter den meistgefragten Partien des Gast-Tenors Färbach werden angeführt: Mozarts Don
Ottavio, Verdis Radames, Mascagnis Turiddu, Leoncavallos Canio, Bizets Don José, Thomas‘ Wilhelm Meister, Kienzls Matthias, dazu offenbar alle Wagner-Tenorpartien: Rienzi, Erik, Tannhäuser,
Lohengrin, Stolzing, Loge, Siegmund, die Siegfriede, Parsifal. Man darf annehmen, dass er auch den Tristan sang. Bemerkenswert ist die Mitteilung, dass Färbach auch in zeitgenössischen Werken
auftrat, so als Chabel in Rudi Stephans Die ersten Menschen und als Elis in Franz Schrekers Der Schatzgräber. Er war auch als Konzertsänger aktiv.
Fähigkeiten und Widersprüche
Die Folge von Färbachs Fest-Engagements weist den Tenor als angesehenen Wagnersänger aus, der zeitgemäß an seinen
wechselnden Stammhäusern ein Rollenspektrum ohne Fachgrenzen sang, vielleicht nicht unlimitiert in der Zahl seiner Partien, dafür aber von enormer Fachbreite. Natürlich hat es immer wieder
„Allessänger“ gegeben (man denke an Patzak, Fehenberger, Traxel), doch bei deren Mehrzahl kann man eine gewisse Entwicklung von Tenorino über den Lirico zum Spinto und dann, fachüberschreitend, noch
Drammatico verfolgen. Färbach aber scheint förmlich alles zu jeder Zeit und nebeneinander im Repertoire geführt zu haben – vom Nemorino bis zum Tannhäuser, im Mittelpunkt die jugendlich-dramatischen
Spinto-Partien und die eher lyrisch angelegten Wagnerhelden
(Erik, Lohengrin, Stolzing, Parsifal).
So etwas pflegt man gemeinhin zu bestaunen. Bei Färbach kann man – jedenfalls nach seiner tönenden Hinterlassenschaft – fallweise auch bedauern. Seine Ton- dokumente mit Stücken aus italienischen und
französischen Opern, vor allem solchen, die reine Tonbildung, gute Legato-Phrasierung und einen varianten Farbenbogen (Chiaroscuro) erfordern, erweist sich der deutsche Sänger als glanz- und
spannungsarm, mitunter desorientiert-unbeteiligt, dazu im sängerischen Mitteleinsatz wie auch im Ausdrucksgestus oft provinziell. Hingegen: Als Wagner-Tenor, noch mehr in den drei deutschsprachigen
Bravourstücken von Strauß, Brandt, Obermeyer, macht er mit kernigem Al-fresco- und Geradeaus-Gesang ohne Mätzchen, doch mit Beweglichkeit und plausibler Text-Ton-Umsetzung Eindruck.
Er hat dann auch keine Probleme mit Registerausgleich, Atemdosierung oder
Stärke-Dynamisierung. Er ist hörbar im richtigen Fach und gemäßen Repertoire.
Als Lohengrin, Walther und Parsifal kann er sogar neben großen Fachkollegen bestehen.
Substanz mit Blessuren
Färbachs Stimmtimbre war nicht von runder, warmer oder glatter Art, trug auch keinen sieghaften oder gar vibranten
Strahl. Man vernimmt eine den Traditionen
des frühen Wagner-Tenorgesangs nahe, mittel- bis hellfarbene, in der unteren Mittellage und Tiefe resonanzreich-baritonal tönende, sonst eher mattmetallische Spinto-Stimme, in der Farbstruktur
weniger nach Silber, mehr nach Natur-Erz hin changierend, also nahezu maßgerecht für dramatischen deutschen Tenorklang,
und damit fast ideal für Wagner. Seine Klang-Range wächst kontinuierlich und weitgehend bruchfrei hinauf bis zur etwas enger werdenden, sich nicht schallkräftig entfaltenden, aber
durchschlagskräftigen, meist schön intergrierten Höhenlage.
An Einsatz und Behandlung von Färbachs tenoralem Material ist wenig auszu-setzen. Die natürliche Wirkung, auch das Timbre
der Tenorstimme haben Nähe
etwa zum Organ Richard Schuberts. Färbach war also solider Stimmbesitzer. Er
zeigt auch Momente respektablen Gesangskönnens, so wenn er in der finalen Fermate von Walthers Am stillen Herd einen sanften Ansatz von Triller einfügt
(Matr. 03386) – also Fähigkeiten besaß, an denen er es in Aufnahmen des Lirico-Bereichs fast dilettantisch fehlen lässt.
Denn wenn es in Kantilenen von Verdi, Opéra und Verismo auf den Einsatz der Grammatik professionellen Singens ankommt –
auf Figurationen, Schattierungen, Farbsetzungen, auf Intonation, Legato, Agilità, Dolcezza, Sfumato – dann hört sich der sonst engagiert singende Tenor manchmal an wie ein Gesangsschüler: entweder
mit Anschein von Wurstigkeit und Desinteresse oder eben auch von Unvermögen.
Gelingt Offenbachs Kleinzack noch pointiert und zumindest atemtechnisch souverän, wenn auch schattierungsarm, so
wird Wilhelm Meisters Romanze Wie ihre Unschuld mit mittelstarkem Einheitston und -tempo beinahe heruntergesungen, kein Hauch von der Poesie, die das Stück prägt. Dem Auftritt des
Rigoletto-Herzogs O wie so trügerisch fehlen Inspiration, Verve, Filouhaftigkeit. In der Holden Aida macht der Sänger eine gebundene Phrase durch rohes Zwischenatmen
zunichte; das Final-B’wird nicht diminuendo verströmt, sondern „durchgefortet“, dafür mit einem Zwei-Töne-Anschmierer attackiert. Manricos Cavatine ist mit exponierten Tonein-fügungen
belebt, die aber leider nicht schön phrasiert, sondern mit Glottisschlägen erzwungen werden; auch fehlt im Finish jeder Anflug von Portamento und Passion.
Schade. Die Wagneraufnahmen entschädigen sehr – ungeachtet auch darin vorhandener Kleinschlampereien. Wir hören das
konkurrenzfähige Spinto-Organ eines Lohengrin, Walther, Siegmund, Parsifal nahe der Ersten Reihe, vermittelt von einem prototypischen Sänger der Zweiten Reihe. Der kenntnisreiche Spezialist für den
ewigen Vorrat akustischer Tondokumente und HAfG-Compagno Michael Seil, gibt dafür einen plausiblen Hinweis: “Man muss bedenken, wie damals Platten produziert wurden – sozusagen aus dem Stand. Oft hatten Sänger und Pianist oder
Instrumentalisten niemals zuvor geprobt, oft mussten Sänger ihnen wenig gelegene Musik einsingen... Als Wagnersänger war Färbach überzeugend – auch wenn er auf der Bühne offenbar viel mehr hergemacht
hat als auf Platten. Seine italienisch-französischen Versuche zeigen, wie wesensfremd ihm diese Musik anscheinend war.“
Sammler werden auf Alfred Färbachs Beiträge zur Diskographie-Geschichte nicht verzichten. Auch sie geben – vielleicht
gerade ihrer Unvollkommenheit wegen – einen Eindruck von den Standards einer großen Ära.
KUS