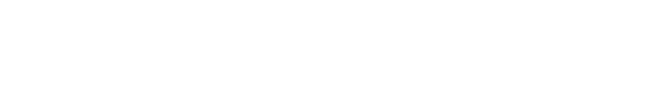Voce
suggestiva
Sándor Kónya – Poesie und Verführung
Ereignisse, die sich unauslöschlich einprägen, halten manchmal auch ein entwicklungsgeschichtliches Datum fest.
Ein solcher Moment war am 23. Juli 1958 frühabends im Bayreuther Festspielhaus zu erleben. Der Bildner-Regisseur Wieland Wagner hatte, nach Parsifal, Ring-Tetralogie, Tannhäuser,
Meistersinger erstmals den Lohengrin in Szene gesetzt.
Ein unterdrücktes „Ahhhh!“ hauchte beim Öffnen des Vorhangs durchs Publikum. Die Bühnenoptik erzeugte einen
Augenblick emotionaler Überwältigung: Das amphitheatralisch zum Publikum geöffnete Szenenrund um Wielands notorische Spielscheibe schimmerte in trunkenen Blauwelten über silbernen Grundtönen.
Zentrales, erregendes Moment des poetisch-suggestiven Szenarios: Eine sinnlich erfassbare Orientierung des Optischen an der Ton- und Klangsprache des Orchestralen. Wie kaum je zuvor wurde hier die
„traumselige“ Assoziationswelt von Wagners Klängen in Bildwirkungen überführt. Ein Effekt, der dem Hörer-Seher neuartige und definitive Wahrnehmungen von den Möglichkeiten eines bis zur
Parodie vernutzt gewesenen Werks erschloss.
Die musikalische Darstellung war dem Konzept in hohem Maß adäquat. Die Erfüllung des Interpretationsansatzes aber
verkörperte sich in der Besetzung des Schwanenritters – der Titelpartie, die wegen der Breite ihrer vokalen Anlage vielfältige Stimmkategorien und Timbrefärbungen ermöglicht, vom Tenore Eroico bis
zum Lirico, von Slezak/Melchior bis Piccaver/Gigli oder Patzak/Wittrisch. Als ideale Besetzung galt seit den späten 1920er Jahren: Franz Völker, die seltene Inkarnation eines fundierten Lirico-Spinto
mit dramatischen Ressourcen, glanzvoll vom Tamino bis zum Otello, trotz oft schwammmiger Artikulation bis heute eine rare Schönklang-Besetzung für Wagners Rienzi, Erik, Tannhäuser, Stolzing,
Siegmund, Parsifal – und eben Lohengrin, die Rolle seines Lebens.
Doch der Sänger, der nun – für Bayreuth noch ein Anonymus – ganz in Gold gewandet, mit goldenem Schwert und Horn,
mit filigranem, schwebendem, doch weittragendem Zauberklang das „Nun sei bedankt ...“ anstimmte, vermochte eine Klangimpression wie aus fernen Welten zu evozieren. Erscheinung und Ausstrahlung, ein
hochindividuelles, unverwechselbar sich einprägendes Timbre, dazu ein dezenter reizvoller, fremd wirkender Akzent verliehen diesem Lohengrin eine Aura des Ungewöhnlichen, beinahe Exotischen, die das
Außenseiterische, Überhöhte, „Gesandte“ der Figur auf aparte Weise zu unterstreichen schien. Das intensivierte sich im Verlauf der Aufführung, verbreitete sich per Radio-Direktübertragung zeitgleich
in alle Welt.
Danach war ein Startenor geboren – mit internationalen Engagements, spektakulären Produktionen, Premieren,
Gastspielen, TV-Portraits und Recital-Schallplatten, alles begleitet von filmstargemäßer Boulevard-Publizität.
Aufstieg zur Spitze – über Nacht
Der Sänger war Sándor Kónya – bis dahin Haustenor der Städtischen Oper Berlin im
italienisch-französischen Repertoire und für besondere Aufgaben. Welterfolge als Sänger der ersten Reihe waren ihm nicht an der Wiege gesungen worden.
Konya kam am 23.9.1923 in Sarkád (Ungarn) zur Welt. Über seine frühen Jahre ist wenig bekannt. Die Informationen
setzen ein mit nichtdatierten Angaben zu einem Gesangsstudium an der Ferenc-Liszt-Akademie Budapest. Der Gesangseleve wurde vom faschistischen Staat kriegsverpflichtet, geriet in britische
Gefangenschaft, wurde 1945 freigelassen, blieb in Westdeutschland. Seine Ausbildung konnte er ab 1946 an der Nordwestdeutschen Musikhochschule Detmold bei dem Pädagogen Fred(erick) Husler fortsetzen.
Durch Studien in Italien soll er sich vervollkommnet haben.
In Nähe des Ausbildungsorts, am Stadttheater Bielefeld, konnte Kónya 1951 als Turiddu in Mascagnis Cavalleria
Rusticana debütieren. Drei Spielzeiten blieb er an diesem Haus, erarbeitete sich ein Grundrepertoire vornehmlich lyrischer Opernpartien. 1954 wechselte er ans Staatstheater Darmstadt. Schon im
Folgejahr wurde er von Carl Ebert nach Westberlin verpflichtet. Im Ausweichquartier der heutigen Deutschen Oper Berlin, dem „Theater des Westens“, war er nun festes Ensemblemitglied – neben Grümmer,
Werth, Trötschel, Musial, Exner, Streich, Dalis, Suthaus, Beirer, Haefliger, Krebs, Grobe, Fischer-Dieskau, Krukowski, McDaniel, Geindl. Ebert hatte endlich eine taugliche Tenorlösung fürs
italienisch-französisch-slawische Fach gefunden, das an der Westberliner Oper seit Weltkriegsende nie wirklich erstrangig besetzt gewesen war, wenn der große Wagnertenor Ludwig Suthaus nicht auch Don
José, Radames, Giasone oder Laca übernahm.
Kónya erschien in Berlin in Opern von Verdi, Puccini, den Veristen, französischen und deutschen Romantikern, von
Webers Max bis Gounods Faust. Mit dem Nurredin in Cornelus’ Barbier von Bagdad gastierte er 1956 beim Edinburgh Festival. Bekannter wurde sein Name in einem anderen Genre: als Träger der
Titelrolle in der spektakulär-skandalösen Uraufführung von Henzes König Hirsch. Ebenfalls am Berliner Haus kreierte er neben Elfriede Trötschel den Michele in der deutschen Erstaufführung
von Menottis Die Heilige der Bleeker Street. Ihm schien eine solide Laufbahn als Erstfach-Tenor an gehobenen Opernhäusern beschieden zu sein.
Niemand hatte ihn als Protagonisten im (damals noch) Welt-Mekka der Wagnerpflege gesehen. Wieland Wagner aber hatte
für Lohengrin nach einem Tenor gesucht, der die Annäherung an einen Schwanenritter „aus Glanz und Wonne“, doch mit melancholisch-gebrochener Psyche, ungewöhnlichen Farben und sensibler,
„poetischer“ Ausstrahlung verkörpern konnte. Kónya erfüllte dieses Konzept. In ihm erreichte die Identifizierung von Rolle und Sänger Maßstäbe, die bis heute nicht durch andere Besetzungen vergessen
gemacht wurde.
Zwei Jahrzehnte „Primo Uomo“
Die Weltkarriere des Tenors entfaltete sich dann in schnellen Schritten. 1958 hatte er in Bayreuth auch den Froh im
Rheingold gesungen. Lohengrin war er dort bis 1960, dann wieder 1967. Bis 1971 folgten Erik, Stolzing, Parsifal. Diese Partien gab Kónya dann weltweit an den Spitzenbühnen. Er erschien in
der Arena di Verona, den Caracalla-Thermen in Rom, an der Scala di Milano, in Wien, London, Paris, San Francisco, Buenos Aires und an der Metropolitan Opera New York. An dieser berühmten Musikbühne
trat Kónya während 14 Spielzeiten auf; sie wurde zu seinem Stammhaus.
Kónyas Rollen in aller Welt waren neben den vier Wagner-Helden vorrangig Webers Max; Verdis Riccardo, Don Carlo,
Radames; Donizettis Edgardo; Gounods Faust; Offenbachs Hoffmann; Bizets Don José, Puccinis Des Grieux, Rodolfo, Cavaradossi, Pinkerton, Kalaf; Mascagnis Turiddu, Leoncavallos Canio. Weitere
interessante Partien sang er in Rundfunkproduktionen – so Smetanas Dalibor und Giordanos Andrea Chénier. Kónya unternahm auch ausgedehnte Konzert-Tourneen. Er pflegte den Liedgsang,
erschien aber kaum in Oratorien oder Orchesterrecitals. Hingegen widmete er sich gern dem Operetten-Repertoire.
Neben dem Lohengrin (der außer in Bayreuth-Mitschnitten von 1958 und 1959 auch in einer US-Studioproduktion unter
Leinsdorf vorliegt) konnte der Sänger nur wenige zentrale Werke seines Repertoire für Schallplatten aufnehmen: Meistersinger, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, in Auszügen auch
Trovatore und Aida, dazu den Alfred in der Fledermaus. In Live-Mitschnitten aus der Met kamen auch Lucia di Lammermoor und Tosca, aus dem Colón Buenos
Aires Les Contes d’Hoffmann heraus. Erfolgreichstes Recital dürften Puccini-Tenorarien bei DG gewesen sein. Auf dem DG-Label Polydor wurden Operetten-Lieder veröffentlicht. Erfreulicherweise
gibt es diverse Arien-Einzelaufnahmen, auch Opern-Querschnitte, dazu Live-Ausschnitte aus Opern- und Konzert-Auftritten. Die meisten sind nurmehr schwer zu finden. Die Kónya-Edition des Hamburger
Archivs versucht dem abzuhelfen.
Sándor Kónya war bis Ende der 1970er Jahre ein international gefragter Tenorstar. Nach seinem Abschied von Bühne und
Podium erhielt er eine Gastprofessur an der Muskhochschule Stuttgart, wo er an der Württembergischen Staatsoper oft gastiert hatte. Er lebte zuletzt am Steinhuder Meer in Niedersachsen. 2002 starb er
auf Ibiza.
Ein Tenor für Fetischisten
Sándor Kónyas Ruhm war stets mit der Darstellung von Wagners Lohengrin verbunden. Das hatte Auswirkungen auf die
über ihn verbreiteten Informationen. Nach 1958 war aus dem „italienischen Tenor auf deutschen Bühnen“ in diversen Medien, bis in Sängerlexika hinein, ein „junger Heldentenor“ geworden, der mit
Wagner-Heroen eine „Heldentenorstimme“ zu Weltruhm geführt habe. Das trifft nicht zu. Kónya war ein echter Tenore lirico, mit reichem Klang, gutem Tiefenregister und schöner Entfaltung eines
melancholisch-elegisch getönten Materials – befähigt zur Darbietung auch dramatisch angelegter Charaktere. Kein Tenore di grazia also, kein Interpret verzierter Musik, sondern ein Tenor fürs lyrisch
ausgelegte Zwischenfach, etwa so wie später Carreras und heute Alagna.
Wagners „leichtere“ = nicht primär heroisch gefasste Tenorpartien: Erik, Lohengrin, Stolzing, Parsifal, genau jene,,
die Kónya sang – sind stets von belastbaren Tenorstimmen des Spinto-Fachs bewältigt worden. Und Lohengrin ist immer auch eine Domäne klangreicher Tenorlyriker gewesen – Aufnahmen mit Piccaver,
Kirchner, Pertile, Gigli, Wittrisch, Anders, Fehenberger, Schock, sogar Tauber, belegen es. Im Fall Kónya erklärt sich der sensationelle Erfolg zudem aus der spezifischen Ausstrahlung von
Persönlichkeit, Timbre und Vokalisation, verstärkt durch die Suggestionen der blausilbernen Wieland-Inszenierung.
Sándor Kónya ist aber kein Fall für Lobpreisungen nach den Maßstäben der klassischen Schule des Gesangskunst. Er
kann kaum als stilverwandt mit den Meistern des Golden Age of Belcanto bezeichnet werden. Zwei Eigenarten sind dafür kennzeichnend.
Zum einen: Kónya zieht die Bruststimme weit in die oberen Stimm-Etagen hinauf, anstatt die Register so abgestimmt auszugleichen, dass jedem aufsteigendem Ton ein Hauch mehr Kopfresonanz
beigemischt wird, womit der Gesangsfluss bis an die Obergrenzen des Stimmumfangs gleich rund, schwingend, modulationsfähig bleibt. Das führt schon ab dem G’/A’ dazu, dass Kónyas Töne häufig spröde,
schwingungsarm, steif und nur mit erhöhtem Atemdruck, oft unter Glottis-Schlägen produziert werden. Von Entfaltung, Emphase, crescendierender Steigerung ist dann wenig zu vernehmen – die Spitzentöne
erklingen oder erschallen nicht, sie scheinen erstellt, erzeugt, erzwungen.
Zum anderen: Kónyas Vokalisation ist nicht völlig sicher. Die Stimme wird mit dem Bestreben nach Volumen-Gleichheit auf allen Höhenstufen eingesetzt. Die Legato-Bindung wird nicht selten durch
ein An-Schluchzen hergestellt, das etwa bei Sforzandi und Morendi nicht mehr nur emotional-sentimental, sondern aufdringlich-exaltiert wirken kann. Namentlich bei längeren, mit Schluchzern
durchsetzen Phrasen, meinen wir dann, einen Wiedergänger des Gigli der 1930/40er Jahre zu hören, desssen berückendes Qualitätstimbre durch Veräußerlichungen und „demagogische“ Vokalgestik entwertet
war.
Kónyas Wirkung und Faszination kommen also nur begrenzt aus sängerischen Qualitäten, weit mehr aus der
Alleinständigkeit seiner Stimme – eines farbintensiven, mit Valeurs prunkenden, an sinnlicher Expression reichen Individualorgans. Wenige Sänger seiner Zeit haben eine vergleichbare Klangwirkung
ausüben können. In einer BR-Gedenksendung war von einem „bronzenen Tenortimbre“ die Rede, eine Assoziation, die man eher einer Eroico-Stimme wie der Lauritz Melchiors zuweist. Zulässig wäre
vielleicht die Variante: eine Tönung von „gold-kupfernem Schimmer“.
Kónyas natürliche Stimmfärbung umfängt die Sinne des Hörers am reinsten und zwingendsten, wenn die Stimme im
Mezzavoce ohne Druck, doch mit voller Nutzung der Resonanzräume, frei schwingen und Melosbögen bilden kann. Dann ist Kónya „at his best“: Die Stimme „sitzt“ und atmet, der Sänger intoniert exakt, das
Legato pulst und fließt, der Klang entfaltet sich wunderschön. Das ist beispielhaft zu hören in Lohengrins Auftritt, in „Atmest du nicht“, im Abschied „Mein lieber Schwan“, in verhaltenen Phrasen und
Parlando-Passagen bei Puccini, in strömender Cantilene bei Donizetti.
Wenn ein auf sängerische Tugenden orientierter Dirigent am Werk ist, der Manierismen und Allüren zu korrigieren
vermag, steht Kónya auch in dramatisch-heroischen Passagen qualitativ über dem heute üblich gewordenen Medioker-Standard dramatischen Singens. Man kann es studieren am Bayreuther Lohengrin unter
Cluytens und Matacic, beim BR-Stolzing unter Kubelik und beim Scala-Parsifal unter Cluytens.
Um dieser Tondokumente willen wird Sándor Kónya zum Bestand der dokumentierten Gesangskunst gehörig bleiben –
zumindest als einer der letzten Repräsentanten für das Ideal gesungener Wagnerinterpretation. Ein interessanter, oft erregender Sänger, Träger individueller Farbigkeit, Sinnlichkeit,
Opulenz.
KUS