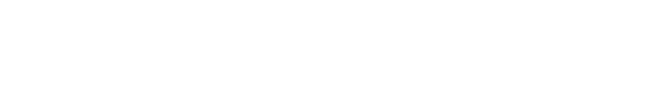Der Schokoladentauber
Klangsinn und Phrasierungskunst: Karl Friedrich
Im Urteil der Fachwelt wie der Laien trägt die Wiener Oper ein dauerhaftes Prädikat: Nummer 1. Durch das ganze 20. Jahrhundert, von der prägenden Mahler-Ära über strukturelle Umbrüche mit Glamour- wie auch Krisen-Phasen bis heute war und ist das Haus am Ring nicht nur das nach Apparat, Repertoire und Personal größte, sondern auch das qualitativ wohl wichtigste Operninstitut des europäischen Kontinents, wenn nicht der Welt. Dies unberührt von Nimbuslegenden wie Scala, Grand-Opéra, Covent Garden, Met. Jahrzehntelang, bis nach dem 2. Weltkrieg, konnte allenfalls die Berliner Lindenoper an Ressourcen und Resonanzen mithalten.
Im Gegensatz zu diesen ruhmreichen Häusern waren die Compagnien des deutschen Sprachraums als Ensembletheater verfasst: mit festen, meist langfristig vertragsgebundenen, oftmals verbeamteten
Stamm-Belegschaften
: Orchestermusikern, Sängerinnen und Sängern, Dirigenten, Spielleitern, Szenikern und natürlich umfassenden staatsbediensteten Administrationen. Das galt nicht nur für
Stadt- und Landestheater, sondern selbst für große Staatsbühnen wie Dresden, München, Hamburg, Stuttgart. Freilich, um ein Wort von Sir Rudolf Bing aufzugreifen: Es handelte sich um Ensembles von
Stars
.
Die Berliner, Dresdner, Münchner und namentlich die Berliner und über allem die Wiener Hof- und spätere Staatsoper, versammelten die berühmtesten Sängerinnen und Sänger der Welt mit deutsch-österreichisch-schweizerischem Kulturfundament, dazu Starkünstler aus jeweils benachbarten Staaten (in Wien vor allem Ost- wie Südosteuropas). Um es an wenigen Namen von Jahrhundertrang festzumachen: Soprane wie Weidt, Kurz, Wildbrunn, Lehmann, Kappel, Jeritza, Nemeth, Cebotari, die Konetzni-Schwestern; Baritone und Bässe wie Demuth, Hesch, Baklanoff, Bohnen, Mayr, Schwarz, Schipper, Jerger, Manowarda, Sved; Tenöre von Slezak, Schmedes, Piccaver, Kiepura, Tauber bis Völker, Rosvaenge, Lorenz. Dazu immer wieder Weltstar-Gäste, von Caruso und Battistini bis Cigna, Giannini, Gigli, Björling, Pinza, Kipnis.
Das Fundament des Opernbetriebs
Seit den 1930er Jahren, nicht zufällig zeitnah zur Ausbreitung der neuen vermarktungstauglichen Wiedergabemedien wie Rundfunk, Film und elektrische Tonaufzeichnung, erreichten Sängergrößen wie die genannten rasch internationalen Starstatus. Ihre Präsenzen begannen sich auf mehrere Welthäuser, Festspielereignisse, Medienauftritte zu verteilen. Sie blieben im Ensembleverbund der jeweiligen Stammhäuser, reduzierten aber ihre Auftrittszahlen. So erreichte ihr Erscheinen mehr und mehr die Wirkung von Stargastspielen — und der groß dimensionierte, ständige, unterbrechungsfreie Spielbetrieb gerade der größten Häuser bedurfte um so beständigerer Ensembles mit hochklassigen Künstlern für alle Fächer. Diese kamen nicht immer zu prominenzsteigernden Tonaufnahmen, konnten aber in ihrem Wirkungsbereich häufig Popularität und Ruhm erwerben.
Wieder auf das Tenorfach bezogen: In den 1930ern verfügte die Wiener Oper neben Reisestars wie Pataky, Tauber, Pattiera, Graarud, Patzak, Völker bis zu Rosvaenge und Lorenz auch über Stammtenöre, die heute Weltrang repräsentieren könnten — wie Schubert, Oestvig, Mazaroff, Kalenberg, Ralf, Gostic und dazu immer gut zwei Dutzend Einspringe- und Gastspiel-Besetzungen ersten Ranges. Seit dieser Zeit war das Haus immer wieder auch interessiert, jüngere, für Wien neue Sänger als verfügbare Ensemblemitglieder zu verpflichten. Manche Karriere hat so begonnen und sich bis weit in die Nachkriegsära fortgesetzt.
Ein idealtypisches Beispiel dafür war Karl Friedrich, ein Sänger mit beachtlicher, zugleich individueller Stimmausstattung, umfassend ausgebildet in der Kunst der Legato-Phrasierung und (dies vor allen anderen Qualitäten für das Wiener Haus von Wert) universell in diversen Fächern einsetzbar. Er sollte dem Haus als eine Art vielseitiger Repertoirealltags-Sänger, zunächst im lyrischen und jugendlichen Tenorfach, im Wortsinne: dienen. So begann sein Wirken auf der berühmten Weltbühne, doch es blieb kaum in solchen Grenzen. Friedrich entfaltete bald eine erstaunliche Expansion seines Repertoires ins dramatische und heroische Fach. Zugleich wurde er aber als Rundfunk- wie als Plattensänger einer der namhaften vielbeschäftigten Tenorlyriker, vor allem mit italienischen und französischen Partien und nicht zuletzt als einer der gefragtesten Operettentenöre seiner Ära.
Eine Karriere von Wien nach Wien
Karl Friedrich wurde in Wien geboren, wuchs dort auf, ging dort erste Berufsschritte, konnte dort auch den Wechsel zum Sängerberuf vollziehen. Er kam aus armem Hause, erlernte zunächst das Tischler-Handwerk, sang auch während der Arbeit auf Baustellen zur eigenen Freude, fiel als Träger einer entfaltungsfähigen Tenorstimme auf, fand mäzenatische Förderung und konnte so ein Vorsingen an der Wiener Musikakademie wagen. Man nahm ihn an, und der 22‑jährige absolvierte ein vier Jahre dauerndes Opernstudium. Als diplomierter Absolvent der hochberühmten Hochschule erhielt er sogleich ein Engagement — als Lyrischer Tenor für die Spielzeit 1931/32 am Staatstheater Karlsruhe. Von dort wechselte er für je eine Opernsaison an die Stadttheater von Ulm, Stralsund, Magdeburg und schließlich Düsseldorf. Er sang das gesamte lyrische Rollenrepertoire, in deutschen, italienischen, französischen, slawischen, auch zeitgenössischen Werken. In Düsseldorf war er rasch als Erstfachsänger mit Publikumsresonanz und Gastoptionen etabliert. Sein Name gewann an Bekanntheit.
So wurde er im Frühjahr 1937 zu einem Gastspiel an der Wiener Staatsoper eingeladen, der Traumbühne jedes deutschsprachigen Sängers. Es fand am 7. Mai 1937 mit dem Don José in
Bizets Carmen statt. Damals nahmen nicht nur Fan-Journale, sondern die ganze Bürgerpresse Kenntnis von solchen Erstauftritten. Der debütierende Tenor
erzielte also sogleich Kritikerresonanz. Sie war freundlich-anerkennend. Man attestierte seiner Tenorstimme Breite, Glanz und leichte Höhe
, dazu warmen Herzenston in der
Legato-Kantilene
. Und: Man habe die Blumenarie selten mit so schöner messa di voce
vernommen.
Das Kritikerurteil (das heute als solches schon eine Rarität wäre) trifft die lebenslangen Eigenschaften des Sängers Karl Friedrich recht genau. Es befasst sich, soweit zugänglich, nicht mit Timbre und Färbung, sondern beurteilt ihn nach sängerischen Kriterien (wieder: heute kaum mehr erlebbar).
Eine Wiener Sängerlaufbahn:
Solide bis spektakulär.
Solche Resonanz begründete nicht nur eine rundum positive Aufnahme des Wiener Tenors in seiner Heimatstadt und ein Festengagement ins legendäre Staatsopern-Ensemble ab 1938. Schon wenige Wochen nach dem Wiener Antritts-Gastspiel brillierte er in der mit extremen Anforderungen zwischen Lirico und Spinto angelegten Partie des Adolar in Webers Euryanthe bei den Salzburger Festspielen, neben Reining, Thorborg und Sved unter der Leitung des schon damals weltberühmten Bruno Walter. Einen spektakuläreren Einstand im Weltrang des Opernlebens dürfte es selten gegeben haben. Karl Friedrich war so mit Beginn seines Wiener Engagements zu einem der Opernprotagonisten der Donaumetropole geworden. Er blieb dem Haus für den Rest seiner Karriere in einem rasch wachsenden Rollenspektrum verbunden. 1939 bis 1943 hatte er zugleich einen Gastvertrag mit der Hamburger Oper. Von 1944 bis 1970 war er dann als einer der führenden ständigen Sänger des Wiener Hauses eine feste Größe im Wiener Kulturleben.
Und hier muss die Einordnung des Tenors in der jüngeren Gesangsgeschichte ansetzen: Den meisten Stimm- und Gesangsfreunden, die Friedrichs Tenor über Tonträger hören, steht eine runde und füllige, klangreiche, sehr eigenständig timbrierte primär lyrische Tenorstimme vor Ohren, vor allem qualifiziert für Musik von weich, gefühlig, melostrunken fließendem Duktus, ideal anmutend für Gounod, Puccini, Massenet, Lehár.
Doch die Schwerpunkte der Bühnenkarriere des Sängers lagen in viel weiter gefassten Bereichen. Er etablierte sich eher als Verdi‑, Wagner- und Strauss-Tenor. An seinem Stammhaus in Wien erreichte er hohe Auftrittszahlen als Florestan, Manrico, Don Carlos, Alvaro, Radames, Don José, Canio, Kalaf, Erik, Lohengrin, Stolzing, Bachus, Apollo, Pedro. Solche eher dramatischen oder Zwischenfach-Partien sang er in häufigem Wechsel mit (in Auswahl:) Tamino, Alfredo, Duca, Gustavo, Faust, Turiddu, Rodolfo, Cavaradossi, Pinkerton, Janek und dem Sänger im Rosenkavalier. Nicht genug, Friedrich bewährte sich auch als Charaktersänger und Tenor-Individualist, so als Grigorij im Boris Godunov, als Phoebus in Notre Dame, als Matteo in Arabella, als Lorand in Korngolds Die Kathrin. Besonderen Erfolg hatte er auf wieder einem anderen Feld, als Operetten-Bonvivant und ‑Liebhaber: an der Wiener Oper als Barinkay im Zigeunerbaron (neben Maria Cebotari) und in der Richard-Tauber-Partie des Octavio in Lehárs Giuditta. Am zweiten Wiener Opernhaus, der Volksoper, wurde Friedrich als Gast in weiteren zentralen Operettenpartien gefeiert.
Multitalent mit Schwerpunktfeldern
Diesem breiten und varianten Spektrum an Bühnenpartien diverser Stile und Fächer entsprechen die Tondokumente, die Friedrich hinterlassen hat, nur zum Teil. Dennoch ist das Material vielfältig, interessant, aussagekräftig. Es setzt aber andere Schwerpunkte als die Biographie des Bühnensängers. Diese ist in ihrer überregionalen und internationalen Dimension eher noch strenger ans klassische Repertoire eines Lirico spinto gebunden: Noch als Gast in Düsseldorf trat Friedrich in der Uraufführung von K. A. Hartmanns Simplicius Simplicissimus auf. 1941 gab er in Salzburg den Sänger im Rosenkavalier, 1950 am Covent Garden London und am Liceu Barcelona den Italienischen Tenor im Capriccio. Mit Erik und Stolzing, Bachus und Kaiser gastierte er in Antwerpen, Brüssel, Neapel, London, Barcelona, Budapest, mit italienischen und französischen Partien in München, Berlin und zahlreichen deutschen Opernhäusern.
Doch zugleich präsentierte sich der Tenor über Medien und bei Sommer-Events mit Operetten (spektakulär bei den Bregenzer Festspielen als Herzog in der Nacht in Venedig von Johann Strauß jun.). Und als Operettentenor hat er, neben schönen, aber nicht allzu häufigen Studiositzungen mit Opernsoli, eine breite Hinterlassenschaft an Tondokumenten produziert, so mit einer Gesamtaufnahme von Lehárs Paganini, neben Esther Réthy, und mit Lehárs Giuditta, beide dirigiert vom Komponisten — auffällig in einer Art Nachfolge des exilierten, schon 1948 verstorbenen Richard Tauber. Die beiden Werkeinspielungen werden ergänzt durch eine Fülle von Operetten-Einzeltiteln und ‑Duetten, besonders attraktiv in einer Serie mit einer bedeutenden Lyrischen des Wiener Opernlebens: Hilde Güden. Friedrich ist aber auch in Überraschungen mit Repertoirewert dokumentiert: in einem Gesamtmitschnitt von Wagners großem Frühwerk Das Liebesverbot, in Heinrich Marschners romantischer Schaueroper Hans Heiling, sogar als Florestan in Beethovens Fidelio und (vielleicht am wichtigsten:) als Apollo in Richard Strauss’ Daphne neben Reining, Dermota, Alsen, Bugarinovic unter Karl Böhm.
Individuelles Profil. Sängerische Qualität.
Künstlerisch und gesangshistorisch muss Karl Friedrich also zu den wichtigen, zeitweise sogar den dominanten Tenören der 1940er bis 1960er Jahre gerechnet werden. Dennoch ist sein Ruhm und Ansehen immer auch rigiden Abneigungen und abschätzigen Urteilen ausgesetzt gewesen. Konzentriert man sich unter Nichtbeachtung von Stil‑, Individualitäts- und Interpretationsfragen ganz auf die sängerischen Aspekte seines Künstlertums, kommt man zu gerechteren, mitunter begeisternden Schlüssen. Friedrich verfügte über eine ursprünglich rein lyrische Tenorstimme, die aber durch offenbar konsequente Schulung in Legatoführung und klassischer Phrasierungskunst zu Tonfülle und Klangpracht gesteigert worden war. Der Umfang ist beachtlich, reicht übers C" hinaus. Die sichere Lirico-Höhe ist ungefährdet verfügbar, was immer der Sänger vorträgt. Die Spitzentöne sind schön gedeckt, der Ton ist weich und warm, der modulierte Klang auf allen Stimmstufen leicht abgedunkelt, was den Höreindruck stets in eine Spinto-Nähe rückt.
Friedrichs technisches Rüstzeug ist so professionell, dass weder an der Intonation und Tonbildung noch an der Linienführung, also Phrasierung, etwas zu bemängeln ist — allenfalls gelegentlich kommt eine Phrase in hoher Tessitura nicht völlig exakt zum Abschluss. Die Fähigkeit des Sängers, von Mozart (den er nur selten gesungen hat), Donizetti und Opéra comique übers zentrale Italo-Repertoire bis zum Tenore drammatico (der er im Timbre eigentlich nicht war) ein enorm variantes Repertoire zu singen, belegt eine mehr als solide, an klassischen Kriterien orientierte sängerische Ausbildung.
Umstrittene Popularisierung
Anders steht es um die Ausdrucks- und Gestaltungskriterien. Karl Friedrich ist schon im Timbre nicht der gleichsam zeitlose klassische Tenortypus, wie ihn vor ihm auf gleichen Fachfeldern etwa
Kirchner, Kraus oder Kullmann verkörperten. Er war stark geprägt von den populären, beinahe modischen Manieren und Allüren der Radiosänger
-Generation, mit betonter Klangsinnlichkeit bis zu
Portamento- und Smorzando-Affektsetzungen, die sich — als eigentlich klassische sängerische Ausdrucksmittel — in außermusikalische Dimensionen verlagerten. Dies oft verbunden mit eher stilwidrigen,
aber als exotisch
empfundenen (vielfach auch bewusst gewollten) Vokalverfärbungen und Exaltationen, vor allem seit der Hochblüte der sogenannten silbernen
Operette (von Lehár und
Kalmán) und des Filmschlagers.
Die zentrale Bezugsgröße und damit Einflusskraft war, neben Tenorstars wie Beniamino Gigli und Miguel Fleta, im deutschen Kulturraum der legendäre Richard Tauber, der gerade über
solche Interpretationsweisen suggestive Wirkungen erzielen konnte und mit ihnen eine ganze Epoche beeinflusste. Um das mediale U-Musikangebot nach Taubers rassistisch bewirktem Zwangsexil
aufzufüllen, später auch an seine Popularität anzuknüpfen, wurden vor allem in Radio und Film fürs leichte Repertoire
und bevorzugt in Operetten gern ähnlich klingende Tenorstimmen eingesetzt.
Beispiele dafür sind Marcel Wittrisch, Jean Löhe und eben Karl Friedrich. Natürlich hatte keine dieser Tenorstimmen ein identisches Tauber-Timbre, doch eine gewisse bis starke
Ähnlichkeit von Färbung und Führung lässt sich nicht bestreiten, und der Einsatz der angedeuteten Gesangsmittel, vor allem der außermusikalischen, war einer inszenierten Tauber-Nachfolge
zuträglich.
Ein Abglanz: Zuckerwatte und Praliné
In der Tat hat das natürliche Timbre Friedrichs eine gewisse Nähe zu dem des vergötterten Medienstars. Es zeigt in einzelnen Gesangsstücken, namentlich von Lehár, sogar frappante Parallelität. Doch es gibt einen wohl entscheidenden Unterschied: Tauber war, bei allen spezifischen Manieren und gelegentlichen Unarten, ein Phrasierungs- und Färbungskünstler ersten Ranges, mit höchster Musikalität fundiert, in meisterlicher Anwendung sängerischer Techniken der klassischen Schule (deren Repertoire er in seiner Zeit nicht zu singen bekam) so genialisch wie versiert. Seine Höhe war — im Gegensatz zu Wittrisch, Löhe und Friedrich — bis zum B" begrenzt, sein sängerischer Vermittlungsglamour somit zugleich raffiniertes Spiel; das hatte auch kompensatorische, um nicht zu sagen: verhüllende Funktion. Taubers Klangfarbenkunst, seine Arbeit mit Valeurs, Nuancen, Akzentuierungen, Finessen ist jedoch ein sängerisches und kunstschöpferisches Ereignis. Die bewussten Doubletten zu Tauber sind demgegenüber Plagiate oder doch Anlehnungen.
Im direkten Vergleich zu Einspielungen von Tauberliedern
in Friedrichs Vortrag wird deutlich: Karl Friedrich hat eine gar nicht so weit entfernte Charakteristik und Färbung — aber sein
Stimm-Material ist schallkräftiger, in der Ausdehnung größer und fülliger, in der Führung souverän, doch nicht ganz so flexibel und bei weitem nicht so farbenreich, im Ausdruck nicht so reich und
variant wie das des großen Vorgängers. Vor allem: Es wird nicht so virtuos und ereignishaft behandelt, wie Tauber das trotz seiner begrenzten Naturmittel vermochte. Wo Taubers Stimme in hundert
Nuancen changiert, ist Friedrichs Klang eher ein wenig wattig, manchmal leicht hauchig-pelzig. Beide Tenöre vermögen starke Sinnenwirkung auszuüben. Doch wo Tauber duftige Baisers serviert, füttert
uns Friedrich mit praliniger Schokolade, an der man sich bei allzu reichhaltigem Genuss auch überessen kann.
Das tönende Erbe
Der harte Vergleich ist natürlich ein wenig ungerecht. Er wurde dem Wiener Tenor eher durch Zeitgeschmack und Medienbedarf aufgenötigt, als von ihm selbst adaptiert. Wer Friedrichs Kunst und Können in eigenständiger reiner Form erfahren möchte, sollte sich nicht nur den zweifellos attraktiven Populärstücken widmen, sondern Friedrich in Opernaufnahmen hören. Das Angebot ist interessant und attraktiv genug.
Nach bereits vorliegenden Recitals des Schallplattenmarkts bringt diese Sammlung des Hamburger Archivs vor allem Fundsachen, die großenteils noch nicht auf CD veröffentlicht waren. Besonders instruktiv Aufnahmen vom NDR Hamburg, WDR Köln, HR Frankfurt/M. und BR München, dann natürlich das kompletten Finale aus Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos neben Maria Cebotari unter Sir Thomas Beecham von 1947 aus London. Für geschworene Fans des Lehár-Interpreten Friedrich ein Wiener Potpourri. Und als Fundsache, die sich nur aus den bedenkenfreien Produktionsusancen der Nachkriegszeit erklären lässt: eine deutsche Radiofassung von Donizettis damals in keinem Opernhaus gespielter Regimentstochter. Friedrich in der mit hohen Cs gesättigten Tenore-di-grazia-Partie des Tonio, hier in einer deutschen Bearbeitung, die Spitzentöne auslässt, aber gerade deshalb die Aufmerksamkeit auf die Phrasierungskunst des Tenors konzentriert — das ist ein Hörerlebnis eigener Art, seine Präsentation auch gerechtfertigt durch die fabelhafte Marie der Wiener Fioriturenkönigin Wilma Lipp.
Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Karl Friedrich dem berühmten Opernhaus seiner Heimatstadt Wien angehört, ein Vierteljahrhundert als Protagonist in mindestens drei Tenorfächern, zuletzt auch als profilierter vielseitiger Comprimario. Er zählte, wie der Wiener Gesangshistoriker Clemens Höslinger es formulierte, zu jenen Bühnenkräften, deren Nützlichkeit, Fleiß und Zuverlässigkeit außer Frage steht als einer der tüchtigsten Sänger, die das Wiener Opernensemble je besaß, fast grenzenlos im Rollenfach, unerschöpflich in seinen gesanglichen Mitteln. Ein Manko, das einer Entwicklung seiner Wirkung zu strahlender Breitenwirkung und Popularität entgegenstand, war Friedrichs begrenzte mimische und gestische Darstellung; er scheint auf der Bühne bei hölzerner, unbeholfener Präsenz vorrangig durch großen Gesang gewirkt zu haben.
Seinem Nachruhm, der sich auf sängerische Qualität gründet, tut das keinen Abbruch. Sein Ansehen wirkt gerade in der Opern-Weltmetropole Wien weiter. Seit 1973 war er Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper. Die Republik Österreich würdigte ihn mit einem Ehrengrab. Sein Erbe verdient Beachtung.
KUS