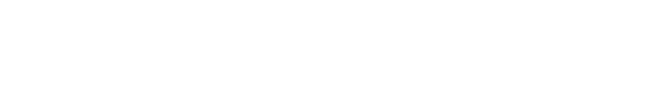Giacomo Puccini (1858 – 1924)
Turandot
Dramma lirico in 4 atti sec. Carlo Conte Gozzi di Giuseppe
Adami & Renato Simoni (compl. di Franco Alfano)
Uraufführung 25.4.1926, Milano, Teatro alla Scala
Deutsche Fassung von Alfred Brüggemann
Mitschnitt einer Vorstellung des Opernhauses Köln
r. live 8. September 1960
Leitung: Miltiades Caridis
| Altoum, Kaiser von China | Albert Weikenmeier |
| Prinzessin Turandot | Walburga Wegner |
| Timur, entthronter Tatarenkönig | Gerhard Gröschel |
| Kalaf, sein Sohn | Herbert Schachtschneider |
| Liù, Sklavin | Liselotte Hammes |
| Ping, Kanzler | Hans Günter Grimm |
| Pang, Marschall | Erwin Wohlfahrt |
| Pong, Küchenmeister | Martin Häusler |
| Ein Mandarin | Heiner Horn |
Chöre des Opernhauses Köln
Gürzenich Orchester Köln
Die Handlung
Erster Akt — Vor den Toren der Kaiserstadt Peking
Ein Mandarin verkündet dem Volk: Prinzessin Turandot wird nur einen fürstlichen Brautwerber heiraten, der drei von ihr gestellte Rätsel löst. Löst er die Rätsel
nicht, wird er enthauptet.
Einer von vielen bisherigen Bewerbern, der Prinz von Persien, ist gescheitert; er wird nun hingerichtet. Freudig erregt erwartet das Volk das neue Schauspiel. — Im Volk
ist auch Timur, ein flüchtiger Tatarenkönig, mit der Sklavin Liù. Er stürzt, Liù schreit um Hilfe. Ein junger Unbekannter hilft ihnen. Timur erkennt in ihm Kalaf, seinen Sohn. Als beim Mondaufgang
(Warum schweigt der Mond?) der schöne Prinz von Persien zum Schafott gebracht wird, schlägt die Stimmung des Volkes in Mitleid um. Vergeblich bittet es die
Prinzessin um Erbarmen. Als sie erscheint, verliebt sich Kalaf, der sie verfluchen wollte, sofort in sie. Trotz Warnungen Liùs und Timurs, des Prinzen Tod vor Augen, will Kalaf den Gong schlagen, um
der nächste Werber zu sein. — Ping, Pang und Pong, Minister des Kaisers, sind beim Volk erschienen. Auch sie versuchen, Kalaf von seinem Vorhaben abzubringen. Liù berichtet Kalaf vom Schicksal seines
Vaters auf der Flucht (Höre mich an, Herr). Kalaf bittet Liù, sie möge für den alten Fürsten sorgen, was immer auch geschehe (O weine nicht, Liù). — Kalaf trotzt allen Warnungen: Er stürmt zum Gong und schlägt ihn dreimal.
Zweiter Akt, erstes Bild — Ein Pavillon
Die Minister Ping, Pang und Pong besprechen die Geschichte Chinas vom Ursprung bis zu Turandot. Sie beklagen die Grausamkeiten der Prinzessin und träumen von einem sorgenfreien Leben auf ihren Landgütern, erkennen aber insgeheim, dass sie vom Kaiserhof nicht mehr wegkommen werden. Von draußen hören sie die lauter werdenden Schreie des Volkes, das sich schon auf eine neue Hinrichtung freut. Der Lärm führt die drei Minister wieder in die Wirklichkeit zurück. Erneut naht die Stunde der Prüfung.
Zweiter Akt, zweites Bild — Ein Platz vor dem Kaiserpalast
Über der Volksversammlung sitzt der Kaiser auf seinem Thron. Er versucht eindringlich, Kalaf von seinem Vorhaben, um die Prinzessin zu werben, abzubringen. Doch Kalaf besteht auf seinem Entschluss. Ein Mandarin verliest die Regeln und Gesetze der Prüfung. — Die Prinzessin Turandot erscheint. In einer flammenden Rede erinnert sie an ihre vor Jahrhunderten von Tataren geraubte Ahnfrau Lo-uling (In diesem Schlosse vor vielen Tausend Jahren). Jedem, der es wage, sie zur Frau zu begehren, werde sie aus Rache für Lo-ulings Schicksals das Leben nehmen. Dann gibt sie Kalaf die drei Rätsel auf. Zum Erstaunen und wachsenden Jubel aller vermag Kalaf alle drei Fragen richtig zu beantworten. Entsetzt bittet Turandot den Kaiser, sie nicht an den Fremdling auszuliefern. Der Kaiser beruft sich auf seinen Eid. Er verfügt, dass Turandot sich fügen müsse. Kalaf bietet Turandot jedoch einen Ausweg an. Er, der unbekannte Prinz, will sie des Eides entheben und den Freitod wählen, wenn sie bis Sonnenaufgang herausfindet, wie er heißt; sie könne dann über sein Leben gebieten. Falls ihr das nicht gelingt, werde sie seine Frau. Der Kaiser willigt ein.
Dritter Akt, erstes Bild — Ein Garten des Palastes
Die Prinzessin hat befohlen, in dieser Nacht dürfe niemand schlafen, bis der Name des Unbekannten herausgefunden werde (Keiner schlafe). Die drei Minister finden Kalaf. Um ihn von Turandot abzubringen, bieten sie ihm Reichtum, schöne Frauen und Ruhm. Doch Kalaf ist seiner Sache sicher. Da werden Timur und Liù, die tags zuvor mit Kalaf im Gespräch gesehen wurden, von Soldaten herbeigeschleppt. Turandot kommt hinzu. Sie erhofft nun den Namen zu erfahren. Liù behauptet, nur sie kenne den Namen des Fremden, aber selbst unter der Androhung von Folter werde sie ihn nicht preisgeben. Als Turandot sie fragt, woher diese Widerstandskraft kommt, antwortet Liù, es sei die Kraft der Liebe, die auch der Prinzessin noch bekannt werde (Du von Eis umgürtet). Da Liù befürchtet, unter der Folter Kalafs Namen doch preiszugeben, entwendet sie einem Soldaten einen Dolch und ersticht sich. Das Volk ist erschüttert. Liùs Leichnam wird weggetragen, vom Volk begleitet. — Kalaf und Turandot sind nun allein. Der Prinz wirft Turandot ihre Grausamkeit vor (Prinzessin des Todes). Er reißt ihr den Schleier fort und küsst sie leidenschaftlich. Nun erst bricht ihr Widerstand. Sie bekennt, Kalaf vom ersten Augenblick an geliebt, wenn auch gefürchtet zu haben. Nun nennt Kalaf ihr seinen Namen und begibt sich damit in ihre Hand.
Dritter Akt, zweites Bild — Im Innern der Kaiserstadt
Turandot und Kalaf erscheinen vor dem Kaiser. Turandot verkündet seinen Namen: Er laute Liebe
. Unter dem Jubel des Volkes sinken sich beide in die Arme und werden glücklich (Zwölftausend Jahre).
Puccinis Schwanengesang:
Unvollendetes Großwerk
zwischen Lyrik, Exotik und Verismo
Gegen Ende der 1910er Jahre war Puccini der vielleicht bedeutendste, sicher aber der erfolgreichste Opernkomponist der Welt und unbestritten der Primo Uomo der Opera Italiana — alleinständig über
dem Zeitalter des Verismo. Seit dem Welterfolg der La Bohème waren alle Puccini-Werke an führenden Opernbühnen der Welt uraufgeführt und sogleich in die
Weltsprachen übertragen worden. Die beiden letzten Eventpremieren, Fanciulla del West und Il Trittico, ereigneten
sich an der Metropolitan Opera New York. Puccini war nicht nur der berühmteste Opernschöpfer seiner Epoche, er war auch zum Ohrwurm
-Lieferanten für die Jeunesse d’orée, die Gesellschaften und
Salons seiner Zeit geworden, Unterhaltungs- und Sensationsstoff wie auch Klatschobjekt des Weltboulevards. Sein privates Vermögen hatte sich ständig vermehrt. Er konnte sich mit neuen Projekten Zeit
lassen, ohne an Rang und Arriviertheit einzubüßen. Dass ihm die Lebenszeit davonlief, war niemandem bewusst.
Die Stoffe der Puccini-Opern reichten von lyrischen Sujets (wie Manon Lescaut und Bohème) über extreme Reißer-Dramatik (wie Tosca und Fanciulla) und parfümierter Morbidezza (in La Rondine) bis zu naturalistischer Tragik (in Il Tabarro), vor allem aber zu artifizieller Exotik (in Madama Butterfly) und ergreifender Seelenarbeit (in Suor Angelica). Was durfte man an Zukünftigem von ihm erwarten? Puccini war stets interessiert an neuen Themen, unvernutzten Milieus und Sujets: Stoffen mit ungewöhnlichen Protagonistinnen, allesamt mehr Opfer als Heldin. Einmal aber sollte dieses Prinzip aufgeweicht (besser aufgespaltet) werden — beim letzten Opernprojekt, seinem keineswegs als Schwanengesang konzipiert gewesenen Opus orientalis: Turandot.
Ausbruch aus Puccini-Welten?
Im März 1920 hatte sich Puccini mit dem Librettisten Giuseppe Adami und dem Kritiker und Dramaturgen Renato Simoni getroffen. Das Gespräch kreiste um den venezianischen Dramatiker Carlo Gozzi und
sein Märchenstück von der gnadenlosen, männerzerstörenden chinesischen Prinzessin. Erstaunlicherweise reizte ausgerechnet der Charakter der eiskalten Turandot den sonst ganz der seelenstarken und
leidensvollen Mädchentypologie hingegebenen Puccini sofort. Das daraus folgende dramaturgische Puccini-Problem
wurde später mit der Rolle der warmherzigen, liebevollen (und, wie stets:
geopferten) Liù gelöst.
Dass dieser Märchenstoff schon mehrmals zuvor vertont worden war, scheint Puccini nicht tangiert zu haben. Ob er Ferruccio Busonis 1917 entstandenes Werk kannte, ist nicht überliefert. Gewiss aber kannte er Antonio Bazzinis 1867 entstandenes Werk Turanda, denn Bazzini war in Mailand sein Lehrer gewesen. Vielleicht reizte es Puccini, die Werke seiner Vorgänger zu überbieten. Schließlich hatte seine Bohème triumphal über das kaum weniger wertvolle Werk Leoncavallos gesiegt.
Von Simoni bekam Puccini die italienische Übersetzung von Friedrich Schillers dem Gozzi-Werk frei nachgestalteten deutschen Turandot-Stück. Eigentlich wollte er sich recht eng an diese Vorlage
halten. Erst später entwickelte er die Figur der Liù als Gegenspielerin (und exaktes Gegenteil) der unwirklich-extremen Titelfigur — nur so konnte ein echter Puccini
entstehen. Um in der Musik
die fernöstliche Welt anklingen zu lassen, suchte der Komponist Rat bei einem Freund, dem Baron Fassini, der viel über China und seine Kultur, Geschichte, Lebensformen wusste. Bei ihm lieh sich
Puccini u. a. eine Original-Spieldose aus und zitierte Melodien daraus in seiner Partitur.
Ein Kampf ums Werk, dann ums Leben
Bis Januar 1921 war das Libretto des ersten Akts mit der Einführung der Liù fertig. Puccini konnte mit der Vertonung beginnen. Er kam auch gut voran. Mit dem zweiten und driten Akt tat er sich
schwerer. Immer wieder gab er Vorschläge und Anweisungen für Textänderungen. Bis März 1924 hatte Puccini die Oper bis nach dem Tod der Liù fertig komponiert. Es fehlte noch das große Schlussbild.
Erst im September erhielt er dafür eine Textvorlage, die ihn zufriedenstellte. Sogleich begann er mit Entwürfen und Vormerkungen. Hierher muss eine markante, schöne,
ungewöhnliche Melodie
, schrieb er zum Text des Schlussduetts. Denn dieses wollte er zum Höhepunkt der Oper machen.
Doch diese Melodie entstand nie. Puccini erkrankte schwer: Seit März 1924 schmerzte ihn der Hals. Man diagnostizierte Kehlkopfkrebs. Am 4. November wurde der Patient in eine Klinik nach Brüssel gebracht, wo man den Tumor mit Radium behandelte. Doch am 28. November hatte Puccini einen Herzanfall, und am Morgen des 29. November 1924 verstarb er.
Die Uraufführung der gespannt erwarteten Oper war schon an der Mailänder Scala angesetzt. Deshalb ersuchte der Dirigent Arturo Toscanini den ihm vertrauten Maestro Franco Alfano, selbst Schöpfer
interessanter Verismo-Stücke (so La Resurrezione nach Tolstoj), eine Vollendung der Oper nach Puccinis Notizen zu wagen. William Ashbrook, der Puccinis
Aufzeichnungen eingehend studiert hatte, bemerkte zum Werk Alfanos: Er hat den leidigen Auftrag löblich ausgeführt. Vor allem hat er sich sorgfältig an die Andeutungen,
Fingerzeige und Phrasen gehalten, die Puccini hinterließ.
Toscanini hielt Alfanos Finale jedoch für zu eigenständig und zu lang, er kürzte es um etwa ein Drittel. Tatsächlich hatte Alfano den Vorsatz Puccinis nicht beachtet, jeden Bombast
zu vermeiden
— und einen gewaltigen, pompösen Schluss komponiert. Auch verzichtete er auf ein symphonisches Intermezzo, wie
es Puccini vorgeschwebt hatte, um den Kuss musikalisch nachzuzeichnen, der Turandot schließlich erweicht. Puccini selbst war mit der Dramaturgie des Finale äußerst unzufrieden gewesen, fand aber bis
zu seinem Tod keine Möglichkeit, es adäquat musikalisch zu gestalten (was durch das Fehlen von Skizzen zum Kuss belegt scheint). Ein alternativer Schluss des italienischen Komponisten Luciano Berio
von 2002 löst das Problem besser, indem er an diesem entscheidenden Angelpunkt der Handlung ein musikalisches Fragezeichen setzt und so das plötzlich eintretende Happy End infrage stellt.
Im Pathos der Unvollendung
Bei der Premiere, die erst eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod stattfand, stand Arturo Toscanini am Dirigentenpult. Über die Uraufführung wird berichtet: Aufgrund seines früheren Ruhms und weil
man einem Toten nichts Schlechtes nachsagen soll, wurde der erste Akt mit stürmischen Beifall quittiert. Nach dem zweiten Akt war der Applaus nur noch höflich. Nach dem Tod der Liù im dritten Akt
legte Toscanini den Taktstock nieder und sagte:
Erst ab der zweiten Vorstellung wurde der Schluss in der heute
üblichen Form aufgeführt.Hier endet das Werk des Meisters. Der Tod nahm ihm die Feder aus der Hand.
Woraufhin ein ergriffenes Schweigen im
Raum lastete, bis eine Stimme vom Rang rief: Viva Puccini!
— und ohrenbetäubender Jubel losbrach.
Puccinis letztes Werk war lange weniger beliebt als die Vorgänger. Inzwischen hat sich Turandot auf den Opernbühnen behauptet. Dieses Opus ist auch immer von einem pathetischen Nimbus umgeben, da es erst nach dem Tod des Komponisten uraufgeführt wurde. Es fasst seine Lebensleistung zusammen und deutet mit einer Vielzahl (vor allem musikdramatischer und chorischer) Innovationen an, wie seine weitere Entwicklung hätte aussehen können.
Perfektion, Farbkunst, Raffinesse
Die Partitur der Turandot bildet eine nochmalige Steigerung der Meisterschaft Puccinis bei der Erzeugung koloristischen und atmosphärischen Raffinements. Das farbenprächtige Milieu der fernöstlichen Märchenwelt wird mit subtilen Mitteln umgesetzt. Eine klangliche Webfülle ohnegleichen an musikalischen Valeurs, melodischen und rhythmischen Ausdrucksnuancen und Gesten wird vor dem Hörer ausgebreitet. Natürlich ist diese Exotik mit europäischen Sinnen und Anmutungen erfasst und für westliche Rezipienten dargestellt: eine ferne Welt, nicht mit deren eigener Musiksprache, sondern mit Assoziationsmitteln der abendländischen Kultur und der Zeit der Entstehung. Während aber der Lyrismus einer vermittelten Japan-Ästhetik in Madama Butterfly marktgängige Klangmodelle aufgreift und damit ein Scheinbild entwirft, wird in Turandot die Unwirklichkeit der Märchenwelt zum Kunstwerk selbst, ist also keine scheinbare Adaption, sondern subjektive Kunstschöpfung.
Der Komponist zieht alle Register seiner spezifischen Fähigkeiten in Können und Kunst: Mit pittoresker Melodik, vorzugsweise pentatonisch (also aus den Fünftonleiter-Systemen) umgesetzt und damit
originalen fernöstlichen Melodiemotiven abgeschaut. Mehr als bei allen Puccini-Opern davor gewinnen ostinate (also widerständig ausgeformte) Rhythmik und heterophone (also verschiedenstimmige,
zwischen Ein- und Mehrstimmigkeit variierende) Harmonik an Dominanz. Das drückt sich aus in ständigen rhythmischen Gewichtsverlagerungen und Taktwechseln. Des Komponisten vertraute abfallende
Motivführung im typischen Puccini-Melos ist auf wenige solistische Phasen, Ariosi und in den fortlaufend durchkomponierten Kompositionsfluss eingewebte Verharrensmomente beschränkt, die aber meist
auffällig kurz sind, kaum als Nummern
gelten können (so Kalafs und Liùs Soli im ersten und Liùs Appell im dritten Akt). Oder sie werden von rhetorisch-rezitativischen Teilen dominiert
(besonders Turandots auf extreme Ekstatik geführter Monolog in der Rätselszene).
Allenfalls das effektvolle Tenorsolo Keiner schlafe ist zu einem Puccini-Hit im Format früherer Tenorschlager geworden, dies aber um den Preis einer künstlich aufgesetzten, vom Komponisten nicht vorgesehen gewesenen extremen Schlussfermate.
Meisterschaft auf neuem Weg?
Der orchestrale Prunk der Massenszenen, die Exaltation einiger Chorphasen und die Vielfalt neuer Klangwirkungen machen Effekt. Den Sängern — vor allem Turandot und Kalaf — wird Enormes an stimmlicher Expansionskraft und Ausdruckintensität abverlangt. Doch dem Zuhörer werden nur wenige Momente des Schlemmens und Schwelgens zugestanden. Bei allem Märchencharakter ist Turandot auch ein Beitrag zum veristischen Musikdrama. Sie wäre damit ein Wegstein auf einem neuen Weg des Komponisten Puccini gewesen, wenn er länger gelebt und gewirkt hätte.
Turandot ist wahrscheinlich Puccinis kompositorisch und instrumentatorisch ausgefeiltestes Werk. Dennoch wirkt es nicht so spontan und inspiriert wie seine Weltbestseller La Bohème und Tosca, eher meisterlich entworfen, kalkuliert konstruiert und realisiert. Es scheint, als ob die eiseskalte Frauenfigur im Zentrum und der wenig zu Herzen sprechende Motivationsgehalt der Handlung nicht den wunderbaren Sinn des Komponisten für die kleinen Empfindungen, Rührungen, Tragiken in Gang gesetzt hätten, mit denen die reizvolle Puccini-Melodik bleibende Rührungswirkungen in der Musikgeschichte etabliert hat.
Ein Werk der Extreme im deutschen Alltagsrepertoire
Wegen der dramaturgischen Anlage erfordert Turandot einen komplexen und differenzierten Bühnenapparat. Breit gefächerte Orchesterbesetzung und diverse Chorgruppen als Träger von Massenszenen, dazu enorme Anforderungen an die Hauptdarsteller — damit steuert das Werk aus gewohnter Puccini-Intimität zur Typologie einer Grand-Opéra (der nur Ballett-Tableaus fehlen). Die Titelpartie stellt die Anforderungen eines Soprano sfogato, also eines hochdramatischen Soprans von hellem, ekstatischem Klang und den gesanglichen Fähigkeiten eines dramatischen Koloratursoprans, ähnlich exaltierten Sopranpartien wie Rezia in Webers Oberon, die Titelpartie in Bellinis Norma, Abigaille in Verdis Nabucco.
Kein Wunder, dass adäquate Interpretinnen von Jahrhundertrang stets rar waren: Die exzeptionelle Rosa Raisa in der Uraufführung, später Britanniens silberne Trompete
: Dame Eva Turner, dann
Italiens Stimmwunder Gina Gigna, eine Generation weiter überwältigend La Divina
Maria Callas in den Jahren vor ihrer Jahrhundertkarriere mit Belcanto-Partien, schließlich der
Heldensopran
Birgit Nilsson (in Turandot mit einem Dutzend Aufnahmen und Mitschnitten dokumentiert), im deutschen Sprachraum interessante, doch eher
Annäherungslösungen — von lyrisch-dramatischer Herkunft wie Maria Cebotari oder Wagner-Heroinen der Niagara
-Richtung wie Gertrude Grob-Prandl. Deutsche Studioproduktionen mit großen
Strauss-Sopranen wie Inge Borkh und Christel Goltz können faszinieren. Marianne Schech, Ingrid Bjoner, Liane Synek hielten sich wacker. Keine bloße Krisenlage also.
Doch dem Charakter einer hochbelastbaren, mit Durchschlagskraft und Stamina ausgestatteten, zugleich ausdrucksgewaltigen und sängerisch befähigten, dabei so stahl- wie schlankstimmig vokalisierenden, also jugendlich (nicht matronenhaft) wirkenden Sfogato-Besetzung entsprach die universelle Walburga Wegner, in unserem Mitschnitt 52 Jahre alt, als Spätstarterin im 21. Karrierejahr. Die Sängerin, die ein schier unglaubliches Fach zwischen Cleopatra/Fiordilligi und Rezia/Kundry bewältigte, war ein bescheidener Star, vor allem an ihrem Kölner Stammhaus (1960 schon im modernen Nachkriegsbau nach Anbruch der Ära Schuh und Sawallisch).
An ihrer Seite ein ebenso universell bewährter, von der Schallplattenindustrie skandalös ignorierter Tenor des jugendlich-dramatischen (und Charakter‑)Fachs: Herbert Schachtschneider — auch er ein Lieblingsprotagonist des Kölner Publikums, zugleich international geachtet und geehrt. Im Kölner Ensemble bekannte und profilierte Namen wie der früh verstorbene exzellente Bayreuth-Mime Erwin Wohlfahrt, die europaweit geschätzte Lirica Liselotte Hammes und der an deutschen Spitzenbühnen populäre lyrische Bariton Hans-Günther Grimm, dazu Kölner Sängerlegenden wie der von der Tonträgerindustrie sträflich ignorierte Bassist Gerhard Gröschel, der grenzenlose Bassbariton Heiner Horn und Kölns Urgestein Albert Weikenmeier. Miltiades Caridis war um 1960 in Deutschland ein Top-Dirigent, populär vor allem als Chef der besonders geschätzten Philharmonia Hungarica. Kurzum: Eine Besetzung, wie man sie hierzulande heute selbst an ersten Häusern nur selten findet — und die doch Staatstheater-Standard der Nachkriegsepoche war.
Deutsche Opernkultur der 1960er:
Europäisches Niveau als Standard
Miltiades Caridis (∗ 1923 Danzig ‑ † 1998 Athen) wurde in der damals Freien Stadt Danzig geboren. Sein Vater war ein griechischer Kaufmann, seine Mutter eine Danziger Bürgerstochter. Die Eltern zogen zunächst nach Weimar um, siedelten sich dann in Dresden an, wo der Junge deutsche Kultur in Fülle aufnehmen konnte, umfassende klassische Bildung erfuhr und bald auch musikalische Studien beginnen konnte. Angesichts der Vorzeichen des Weltkriegs wanderte die Familie 1938 nach Griechenland aus. Ausweislich des Greece Music Review war Caridis das einzige Mitglied seiner Dresdner Schulklasse, das den Weltkrieg überlebte. Nach Kriegsende ging er nach Wien und erreichte die Aufnahme in die Dirigierklasse des legendären Hans Swarowsky, der so bedeutende Orchesterleiter ausbildete wie Claudio Abbado, Paul Angerer, Gabriel Chmura, Mariss Jansons, Adam & Iván Fischer, Jesus Lopez-Cobos, Zubin Mehta, Peter Schneider, Mario Venzago, Bruno Weil, Hans Zanotelli u. v. m. Caridis’ Laufbahn begann schnell: Schon 1947 debütierte er als Kapellmeister in Bregenz, war ab 1949 zehn Jahre lang Chefdirigent in Graz, dann bis 1962 fest am Opernhaus Köln, ab 1962 auch ständiger Gast an der Wiener Staatsoper. Bis 1967 war er Leiter der renommierten Philharmonia Hungarica, zugleich des Radio-Sinfonieorchesters Kopenhagen, bis 1976 Direktor der Nationalen Philharmonie Oslo, bis 1981 GMD in Duisburg, bis 1985 Chef des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters. Von 1995 bis zu seinem Tod leitete er noch das Nationalorchester Athen. Er war der renommierteste griechische Dirigent seit Dimitri Mitropoulos.
Walburga Wegner (∗ 1908 Köln ‑ † 1993 Köln) war eine
der angesehensten dramatischen Sopranistinnen im Nachkriegsdeutschland. Sie trat an führenden deutschen und internationalen Bühnen auf, vom Opernhaus Köln bis zur Mailänder Scala, Grand Opéra Paris,
Covent Garden London, Staatsopern Hamburg und Wien und zur Metropolitan Opera New York. Nach einem 10‑Jahres-Lebensintermezzo in Chile war sie erst ab 1935 Meisterschülerin an der Musikhochschule
Köln. 1938 erwarb sie Diplome als Musiklehrerin für Konzert- und Operngesang. Im Konzert debütierte sie 1939 in Köln, in der Oper 1940 am Opernhaus Düsseldorf als Spielaltistin Suzuki in Madame Butterfly. Es folgten Partien des Mezzo- und Alt-Repertoires. 1942 trat Wegner ein zweites Festengagement am Oberschlesischen Landestheater in Beuthen an. Die
Zwangspause im Totalen Krieg
nutzte sie zu erneutem Studium beim bedeutenden Kölner Gesangsprofessor Clemens Glettenberg, der sie zum dramatischen Sopran aufbaute. Ihre eigentliche Karriere
begann ab 1947 an der Kölner Oper mit Ariadne auf Naxos. Bald war Wegner eine Spitzenkraft des Hauses mit überregionalen und dann europaweiten Auftritten.
Ihr Repertoire war vielfältig — mit Mozarts Fiordilligi, Donna Anna, Elektra, Monteverdis Poppaea, Händels Cleopatra, Beethovens Fidelio, Glucks Euridice, Webers Rezia, den Wagner-Partien Senta,
Elisabeth, Ortrud, Eva, später Kundry, von Verdi die Leonoren, Amelia, Elisabeth und Aida, Offenbachs Giulietta, Puccinis Manon Lescaut, Tosca und Turandot, von Richard Strauss auch Salome,
Marschallin, Arabella, Mascagnis Santuzza, Tschaikowskys Tatjana und Lisa, Jaroslavna in Borodins Fürst Igor. Martha in Tiefland. Dazu bot die Sängerin Solopartien in Oratorien, Kantaten, Messen und Konzertstücken von Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz, Brahms,
Bruckner, Pfitzner, Sibelius, ferner Opern der Moderne und Lied-Recitals. Während ihrer gesamten Bühnenlaufbahn war Walburga Wegner Ensemblemitglied des Kölner Opernhauses. Mit der Titelrolle in
Tosca nahm sie 60‑jährig in Köln ihren Bühnenabschied. Trotz ihrer Bekanntheit hatte sie keinen Schallplattenvertrag. Ihre einzige offizielle
Schallplattenaufnahme ist die Titelpartie in Salome von 1954 unter Rudolf Moralt. Es gibt aber gute Live-Mitschnitte aus unterschiedlichem Repertoire. Das
Hamburger Archiv hat Walburga Wegner eine 3‑CD-Edition gewidmet.
Herbert Schachtschneider (∗ 1919 Allenstein/Ostpreußen ‑ † 2008 Köln) kam aus Ostpreußen nach Berlin, studierte dort an der Musikhochschule, anschließend weiter bei Hans Nachod in London. Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft konnte er seine Sängerlaufbahn 1953 am Landestheater Flensburg beginnen. Er stieg schnell auf: Über Mainz und Essen erreichte er 1959 das Opernhaus Köln, wo er bis 1984 Ensemblemitglied blieb und ein breites Repertoire für jugendlich-dramatischen Tenor darbot. Mit Gastverträgen war er zugleich den Opernhäusern Frankfurt/M., Hannover und Zürich verbunden. Er hatte Auftritte am Westberliner Opernhaus (1956), beim Holland-Festival (1958), in der Royal Albert Hall London (1963), am Teatro Colón Buenos Aires (1967), am LaMonnaie Brüssel (1968), seit 1969 an den Staatsopern Wien, München, Stuttgart und an der Mailänder Scala, ab 1971 bei Gastspielen in Italien und Spanien. 1959 war er in Köln an der Uraufführung von Dimitri Nabokovs Der Tod des Grigorij Rasputin beteiligt. Seit 1972 war er erst als Dozent, dann als Professor an der Musikhochschule Saarbrücken tätig. Schachtschneiders Glanzpartien lagen im jugendlichen, vor allem aber im dramatischen Fach, u. a. Erik, Lohengrin, Tannhäuser, Stolzing, Radames, Hoffmann, Hermann, Kaiser, Bacchus, Pedro. Er brillierte in Charakterheldentenor-Partien wie Loge und Busonis Mephistopheles. Doch er war (neben Eugene Tobin) auch die Kölner Erstbesetzung für Verismo und Puccini, von Canio über Cavaradossi bis Kalaf. Auch im Konzertsaal war er vielgefragt. Die Schallplatte hat ihn zu Unrecht übergangen: Zwar wurde er als Lohengrin dokumentiert, sonst aber nur in Werken der Moderne wie Schoenbergs Gurreliedern und Von heute auf morgen. Sein Loge unter Wieland Wagner und Wolfgang Sawallisch liegt als Mitschnitt vor. Das Hamburger Archiv wird weitere Aufnahmen herausbringen.
Liselotte Hammes (∗ 1933), Rheinländerin, eine universelle Musikerin, ausgebildet an der Musikhochschule Köln als Pädagogin, Pianistin und Sängerin. Sie debütierte 1957 in Köln als Eurydike in Glucks Orpheus. Vom Opernhaus Köln aus kam sie rasch zu Gastspielverpflichtungen in ganz Europa — so seit 1962 an der Hamburgischen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, den großen Opernbühnen von Paris, Genua, Neapel, Rom, Triest, Lissabon, dann an der Mailänder Scala und beim Glyndebourne Festival. Ab 1968 war sie nur noch als freie Gastsängerin tätig, bleib aber der Kölner Oper bis 1973 eng verbunden. Danach nahm sie ihren Bühnenabschied und wirkte fortan als Musikpädagogin, u. a. an der Musikhochschule Köln. Sie betreut bis heute eine Reihe prominenter Sänger. Zu ihren jüngeren Schülern zählen Stars wie Anja Harteros und Thomas J. Mayer. Das Repertoire von Liselotte Hammes umfasste über 70 Partien des Leggiera- und Lirica-Fachs, darunter Susanna, Pamina, Marzelline, Mimi, Liù, Nedda, Marie, Sophie, Zdenka, die Kluge, die Hauptgestalten der deutschen Spieloper, leichte Sopranpartien von Wagner (Hirt, Woglinde, Waldvogel, Blume) und Strauss (Najade, Falke, Hermione), wie aus der französischen und slawischen Oper, auch der Moderne, dazu ein umfassendes Konzert- und Oratorien-Repertoire.
Gerhard Gröschel (∗ 1902 – † 1996) stammte aus Aussig in Nordböhmen. Er wurde seit dem Stimmbruch auf den Sängerberuf vorbereitet und gründlich in
allen musikalischen Fächern ausgebildet — erst in seiner Heimatstadt, dann in Salzburg, später in Berlin. Er konzentrierte sich lange nur auf den Konzertgesang, schien eine Karriere als
Oratoriensolist zu machen. Auf der Opernbühne debütierte er erst 34‑jährig am Landestheater Gera 1936 als Don Basilio in Rossinis Barbier von Sevilla. 1938
wechselte er ans Staatstheater Darmstadt, weitere drei Spielzeiten später 1941 ans Opernhaus Köln. Dort fand er seine bleibende künstlerische Heimat als erster Vertreter für alle Bassfächer und blieb
für 30 Jahre der beim Publikum hochangesehene und beliebte Basso serioso e cantante in einem breiten Repertoire mit den Schwerpunkten Wagner und Verdi. Er war aber auch als Spiel- und Charakterbass
erste Wahl und übernahm markante Partien in Werken der Moderne. 1948 wirkte er in der Uraufführung der Oper Verkündigung von Walter Braunfels mit. Zu seinen
zentralen Partien gehörten Sarastro, Figaro, Publio, Seneca, Rocco, Daland, Landgraf , König Heinrich, König Marke, Pogner, Gurnemanz, Philipp II, Banquo, Procida, Fiesco, Guardiano, Fürst Gremin,
Graf Tomski. Nach seinem Bühnenabschied wurde er 1972 zum Ehrenmitglied des Kölner Opernhauses ernannt. Während seiner ganzen Laufbahn trat er auch als Konzert- und Oratoriensänger auf. Seine
balsamisch-sonore Bassostimme ist in zahlreichen Rundfunkproduktionen und Live-Mitschnitten zu hören, kam aber nur selten in offiziellen
Schallplattenproduktionen zu Gehör. Sein Timur in
diesem Turandot-Mitschnitt ist darum ein wichtiges Tondokument.
Hans-Günther Grimm (∗ 1925 – † 1999) stammte aus Düsseldorf, erregte schon als Knabensopran Aufsehen, war Schüler der Professoren Landi in Berlin und konnte 1950 gleich an der Berliner Staatsoper debütieren. Zwischen 1952 und 1957 war er an den Opernhäusern Bremen, Mannheim und Frankfurt/M. verpflichtet, 1957/58 auch am Opernhaus Zürich. 1960 bis 1964 war er erster lyrisch-dramatischer Bariton, vor allem im italienischen Fach, am Opernhaus Köln. Danach arbeitete er als freier Gastsänger an wichtigen deutschen Opernbühnen der Staatstheater-Kategorie, von Dortmund bis München. Er gab Opern- und Konzertgastspiele in Frankreich, Italien, Spanien, Japan und USA. Zu seinen zentralen Partien zählten Mozarts Conte, Don Giovanni, Guglielmo, Papageno, Beethovens Don Fernando, Rossinis Barbier, Cimarosas Conte Robinson, Donizettis Malatesta, Verdis Luna, Germont, Renato, Carlo, Posa, Ford, Wagners Wolfram, Lortzings Kühleborn, Bizets Escamillo, R. Strauss’ Harlekin. Grimm war auch als Oratorien‑, Lied- und Operettensänger erfolgreich. Zahlreiche Einspielungen vor allem aus diesen Genres bewahren seine Kunst. Seit 1973 übte er eine Professur am Konservatorium von Maastricht/NL aus.
Erwin Wohlfahrt (∗ 1931 – † 1968), vielgeliebt und früh verstorben, war neben Unger, Kuën und Stolze der führende Buffo- und Charaktertenor der 1950er und 60er Jahre. Er erlernte das Friseurhandwerk, ließ sich aber zu einem Vorsingen bei dem berühmten Bariton Willi Domgraf-Faßbaender überreden, dessen Schüler an der Musikhochschule Nürnberg er dann wurde. Er absolvierte weiter bei Foesel, Gebhard und Hermann das gesamte Bühnenstudium, dazu Klavierspiel. 1955 debütierte er als Adam in Zellers Vogelhändler in Aachen, wo er auch sein erstes Festengagement hatte. 1957 wechselte er ins Felsenstein-Ensemble der Komischen Oper Berlin, von dort ab 1959 ans Kölner Opernhaus, dann an die Hamburgische Staatsoper. Nun wurde er europaweit bekannt und gefragt — als Sängerdarsteller von Operngestalten jeder Art, nicht zuletzt im zeitgenössischen Musiktheater. Er wirkte in Uraufführungen von Werken Klebes, Bibalos, Schullers und Searles mit. In allen wichtigen Tenorbuffo-Partien errang er Ansehen und Ruhm, am meisten mit Wagners David und Mime, so seit 1963 bei den Bayreuther, und als Mozarts Pedrillo, so seit 1960 bei den Salzburger Festspielen, an der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala, der Grand-Opéra Paris, dem Bolshoj Moskau. Wohlfahrt gastierte in ganz Europa. Sein exzellent musikalischer Gesang ist in zahlreichen Aufnahmen zu vernehmen. Er starb erschreckend früh an Leukämie.
Albert Weikenmeier (∗ 1908 – † 1981), Heiner Horn (∗ 1920) und Martin Häusler († 2012) waren langjährig verdiente, zeitweise auch hochpopuläre Mitglieder des Kölner Opernensembles. Weikenmeier galt als Multitalent: Er ist auch
als virtuoser Geiger aufgetreten, war Mitglied zahlreicher deutscher Opernhäuser wie Breslau, Bamberg, Krefeld, Kaiserslautern, Braunschweig, Hannover, Düsseldorf und als Gast in europäischen
Musikzentren und bei Festivals (London, Paris, Edinburgh, Florenz, Amsterdam, Warschau). Ab 1950 war er dauerhaft am Kölner Haus tätig, mit Erfolgen als genre-überschreitender Lyrischer Tenor, vor
allem im italienischen Fach, später als Charaktertenor und Spezialist für interessante Aufgaben
. — Heiner Horn kam 1952 an die Kölner Oper und war gut 30 Jahre lang der Hausbassist und
Bassbariton ohne Grenzen in zahllosen Produktionen. Er hat mehr als 100 Rollen verkörpert und stand meist wöchentlich mehrmals auf der Bühne, dazu im Konzertsaal und Rundfunk. Horn war stets ein
Liebling des Kölner Publikums. Sein Stimmumfang war enorm; das befähigte ihn zu Fachüberschreitungen nach Belieben. Neben den Partien des seriösen
Bassfachs sind bemerkenswert: Pizarro,
Kaspar, Sparafucile, Guardian, Holländer, Fasolt, Klingsor, Mephistopheles, die Hoffmann-Bösewichte, Jochanaan, Wozzeck, dazu Buffopartien wie Basilio, van
Bett, Baculus, Plumkett, Kezal. An der Grand Opéra Paris war er der Titelheld in der dortigen Wozzeck-Erstaufführung. — Der Charaktertenorbuffo Martin
Häusler war einer jener unverzichtbaren Ensemblestützen eines großen Hauses, die in Hunderten kleiner Aufgaben und einem Dutzend markanter Profilpartien Gewicht gewinnen — so wie Zimmermann, Kraus,
Vantin in Berlin, Buchta und Pfeifle in München, Carnuth, Kuën und Lenz in München, Marschner in Hamburg, Klein und Dickie in Wien. Häusler gastierte an vielen Bühnen des deutschen Sprachraums, bis
an die Berliner und Hamburger Renommierbühnen. Er wirkte in diversen Radio- und Plattenaufnahmen mit. Leider ist in Sängerlexika und Archiven kaum etwas über ihn zu finden. Rollen wie der Pong in
Turandot waren sein Metier.
KUS