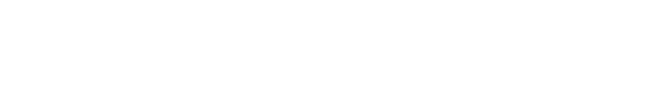WerbeWandel
In den goldenen Zeiten, als unser aller Pressepapst E. Dovivat die Kommu-
nikation zur Zeitungslehre verdichtete und von Weimar übers Dritte Reich zur Republik ungebrochen ex cathedra lehrte, da war Marketing nichts als eine Luftblase angloverderbter Windmacher. Da betrieb
man Werbung.
Und Werbung war Reklame.
Da wusste man noch, wie’s geht und worauf’s ankommt. Und das ging so:
So wichtig wie die Braut zur Trauung / ist Bullrich-Salz für die Verdauung.
Oder: Nur Miele, Miele sprach die Tante / die alle Waschmaschinen kannte. Da machte das Business noch Spaß. Und jeder war, beim Hute des Beuys, ein Werber. Zumindest Werbeträger. Das
ging solange, bis die Witze über OMO-Sexualität in Umlauf kamen. Da spätestens schlug die Stunde der Seriositätskumulation durch Verwissenschaftlichung. Und aus war’s mit
dem Spaßvergnügen.
Seither kennt man keinen ‑Ismus und keine ‑Ologie mehr, die den Werbebetrieb noch nicht heimgesucht hätte. Nun kamen Naturburschen und Universalisten in Verruf, die Awards in Schwang und Schwung. Und die Akademien, Symposien, Workshops. Und vor allem die kupfertiefgedruckten Vierfarbstrecken im stern. Wer, ob Creative Director, Contact Group Chief, Copy Head, Art Director oder Design Assistent, die Mitwirkung an mindestens einer solchen nachweisen konnte, war bereits ein Vice President in spe. Zumindest am Tresen der Kneipe gleich um die Ecke der Agency. Wem stand da noch der Sinn nach Reklame?
Und heute? In der dritten Generation der Kommunikation als Profession scheinen die schönen, die goldenen Zeiten erneut passé. Jetzt geht’s um Exploration, Multivision, Interaktion — in jedem Fall
aber um Innovation. Das wissen alle, das sagen alle. Sogar die alten Filzschaften haben die Terminologie längst drauf (die Neue Mitte sowieso). Weil nun davon die Zukunft abhängt.
Die aber ist so multivisional wie multivisionär. Die Krux ist nur: Jeder kann sich einklinken. Selbst die Kids haben das schon locker im Griff. Und damit droht
die ganze mythisch-hermetische Aura eingeweihter Schamanen endgültig zum Teufel zu gehen.
Andererseits: Vielleicht schafft gerade dies den Einstieg in eine Professionalität ohne Bruch. Kommunikation kann zur rationalen, zur plan- und steuerbaren Lebenstechnik werden — zur Mobilisierung von Wissen. Die Qualität der Kommunikationsarbeit könnte dabei gewinnen. Zwar nicht so sinnlich-spaßig-goldig wie ehedem — dafür messbar wirksam. Eigentlich keine so schlechte Aussicht.
(SZ Supplement 2000)
Aus reiner Selbstachtung:
Ein Moralist
Der Dachauer Volksvertreter Hans Philipp
Der Dachauer SPD-Kreisrat Hans Philipp (Wohnort Indersdorf. Standort
immer halbrechts hinter seinem Chef Hans Hartl) ist ein Mann von Ehre, mit Shakespeare zu sprechen: ein ehrenwerter Mann
. Seine Selbstachtung geht
ihm über alles. Auch über sozialdemokratische Grundhaltungen. Darin hält
er auf Kontinuität. Seit Jahren schon.
Als der Polit-Hasardeur Hans Hartl auf dem Wege von CSU über FDP zu
einer Christlichen Bürger-Union (CBU) kurze Zwischenstation als parteifreier Bürgerkandidat
machte, gebot es dem Philipp die Selbstachtung, in meiner Eigenschaft als Lehrer und Vertreter
einer demokratischen Partei gegen den amerikanischen Wahlkampfstil des Dr. Hartl zu protestieren.
Mit dem demokratiefeindlichen Gehabe von Politikern wie Hartl haben wir Deutsche
in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht, stellte Philipp damals fest -
und ließ keinen Zweifel daran, welche Vergangenheit er meinte. Die öffentliche Reaktion auf Hartl sei ein Testfall für den Stand des demokratischen Bewusstseins
der Dachauer Bevölkerung. Das musste einfach gesagt werden. Schon aus Selbstachtung.
Wenige Jahre später stand die Selbstachtung des Philipp erneut auf dem Prüfstand. Sie hatte hartem Sturm standgehalten. Denn jetzt trat der demokra-
tisch bewusste Philipp als Vorkämpfer jenes Hartl auf, der ihn zuvor an unseligste Zeiten erinnert hatte. Ja, der Aufstieg zum SPD-Kreisvorsitzenden
auf Hartls Ticket ist dann schon mal eine Selbstachtung wert.
Die Süddeutsche Zeitung brachte es auf den Punkt: Fast scheint es, als habe
Und, an die Charakterisierung Hartls durch Philipp erinnernd: Es
zeuge von einer
der Röhrmooser Hauptschullehrer das, was er damals so brandmarkte, mittlerweile zum Maßstab seines eigenen Handelns gemacht.zynisch-verächtlich machenden
.
Weise, wie der Kreisvorsitzende Philipp mit den Statuten der Partei umgeht
Als Philipps neues Idol Hartl dann bei der Landtagswahl 1986 genau den Wahlkampfstil zur Perfektion ausbildete, den ihm Philipp zuvor mit härtesten Worten angekreidet hatte, da stand ihm dieser -
nunmehr als Pressechef - wortgewaltig zur Seite. Die souveränen Wähler, deren demokratisches
Bewusstsein Philipp seinerzeit stark herausgefordert sah, hätten sich nun mal
für seinen Helden entschieden und damit Politik auf neuer Basis möglich gemacht. Eine neue Basis Philippscher Selbstachtung gab’s gratis dazu.
Selbstachtung war es gewiss auch, die Philipp befahl, eine von Hartl bezahlte Zeitungsanzeige zu unterzeichnen, in der dem SPD-Bezirk Parteispaltung unterstellt wurde, weil er in Oberbayern mit
Adresse Dachau ein Kulturforum ermöglichte. Und als ein kritisches Taschenbuch erschienen war, in dem der Dr. Hartl als besonders abstoßendes Symptom für eine neue Generation
überzeugungs-frei-machtorientierter Provinzpolitiker
beschrieben wurde, da gebot es Philipp die Selbstachtung, solche Bloßstellung vorrangig als Indiz dafür zu werten, dass
die Popularitätskurve des neuen Filser im roten Wams steil nach oben zeigt.
Ohne Zweifel war es reine Selbstachtung, die Philipp veranlasste, im Dachauer Kreistag gegen Anträge zu stimmen, mit denen eine Orientierung künftiger Dachauer Jugendbegegnungsarbeit am Vermächtnis des Widerstands gegen das Nazi-Regime gefordert wurde. Wenn es um Philipps Selbstachtung geht, dann müssen eben auch klassische SPD-Überzeugungsinhalte zurückstehen.
Kein Zweifel: Auch die Erklärungen, mit denen Philipp bald darauf die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Dachau und die Ziele des Fördervereins Internationale Jugendbegegnung öffentlich herabsetzte ("Gefahr linksradikaler Infiltration"), entsprangen ausschließlich konsequenter Wahrung des Prinzips Philippscher Selbstachtung.
Dieses Philipp-Prinzip schlägt nicht zuletzt bei der Auswahl jenes Mediums durch, das Philipp für offenen und verdeckten Informationstransfer bevorzugt: der einschlägig ausgewiesenen CSU- und
Hartl-Postille Münchner Merkur /Dachauer Nachrichten, vulgo Göttlers Lügenblatt
.
Man erkennt das schon daran, dass Philipp dessen Redaktionsleiter frühere Kritik genauso wenig verübelt wie dem Hartl das demokratiefeindliche Gehabe
: Jener hatte an Philipp
nämlich früher einmal die Maske des Biedermanns
erkannt, ihm ferner Tugenden, die früher bei Sozialdemokraten gang und gäbe
entschieden abgesprochen:
waren und die Philipp erst noch lernen mussEhrlichkeit und Anstand
.
Wo soviel Selbstachtung das Handeln diktiert, kann eine neuerliche Philipp-Konsequenz nicht überraschen. Weil die Mitgliederversammlung des laut Philipp ohnehin Ideologie
-verdächtigen
Fördervereins mit jeweils über
90 % der abgegebenen Stimmen einen Vorstand wählte, dessen Zusammen-setzung nicht den Anforderungen Philippscher Selbstachtung entsprach, machte er der Dachauer CSU die Freude und trat aus der
Vereinigung aus. Nicht ohne dies sogleich über den Münchner Merkur (den wütendsten Gegner des Projekts Internationale Jugendbegegnung) verlautbaren zu lassen: Dies gebiete ihm,
na was schon: seine Selbstachtung.
Und weil Philipp das Gebot der Selbstachtung über alles stellt, attestierte er
in öffentlicher Sitzung des Dachauer Kreistags bald darauf auch der örtlichen CSU, sie habe völlig recht, wenn sie den Förderverein als linksextrem bezeichne. Dessen sozialdemokratische
Kuratoriumsmitglieder Hans-Jochen Vogel, Heinz Westphal, Jürgen Schmude werden dieser Demonstration von Selbstachtung
den Respekt nicht verweigern.
Philipps Selbstachtung hingegen verlangte mehr: Vor allem jenen Sozial-demokraten, der sehr zur Belastung der Philippschen Selbstachtung in dem Förderverein an die Spitze gelangt sei, den halte er für politisch und moralisch völlig unglaubwürdig.
Glaubwürdig und moralisch ist demnach, wer - wie Philipp - beim Hartl in Dienst geht: einem Mandatar, den ebendieser Philipp mit den Nazis gleich-gesetzt hat. Aus reiner moralischer
Glaubwürdigkeit selbstverständlich. Und
aus Selbstachtung.
Alle Achtung!
(s. Auskünfte / Notate / Denkmal für Hans Hartl)
Bürgermeisterwahl 2014
Der Amtsträger hat das Wort
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Damen und Herren Gäste, liebe Mitbürger!
Was ich sagen will, schon immer gesagt habe — wir sind alle aufeinander angewiesen, einer braucht den anderen. Und ich sage Ihnen, wir
haben schwierige Aufgaben vor uns, die Bäume wachsen auch in dieser schönen Großgemeinde nicht in den Himmel. Da muss manches niedriger gehängt werden. Denn wir haben einfach die Mittel, die
finanziellen Möglichkeiten
nicht dafür. Da dürfen wir niemandem etwas vormachen.
Unsere Menschen befinden sich ja in großer Irritation. Sie brauchen politische Anwälte aus Verantwortung, Vertreter ihres Vertrauens. Und
ich sage, es ist
am besten, den Menschen reinen Wein einzuschenken, alle Karten auf den
Tisch zu legen. Man muss ehrlich sprechen, sage ich immer.
Ja, ich bin besorgt und beunruhigt. Ich sage das frei heraus. Da darf man vieles nicht einfach wegwischen. Da ist manches von großem Gewicht. Ja, es geht oft um sehr viel mehr, und wir sind alle mitverantwortlich, sitzen doch alle im selben Boot. Wir alle müssen wissen, wohin die Reise geht. Und wir müssen …
Zwischenfrage
Das ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Frage. Und diese Frage wie auch weitere Fragen in dieser Richtung werden immer wieder auf dem Tisch liegen, zentnerschwer. Wir müssen da sehr nuancierte Antworten geben, ganz sachgerecht, ganz konkret. Und ich will auch gar nicht verschweigen, dass man da früher manches gesagt hat, was man heute so nicht mehr sagen würde. Wir leben in einer Zeit der Veränderungen, ob uns das passt oder nicht, und diese Gemeinde ist ja doch unser aller Lebensraum.
Wir haben viel geleistet. Aber manches ist erst noch zu tun. Und vergessen wir auch nicht, uns immer wieder zu fragen: Was denn, wenn es anders kommt?
Ja, nehmen wir uns nicht zu viel vor, nehmen wir den Mund nicht zu voll. Entzünden wir keine kurzfristigen Hoffnungen. Wir dürfen doch
nicht den Anschein erwecken, dass unseren Menschen immer nur Versprechungen gemacht werden. Wir müssen vorausdenken. Die Geschichte dauert nicht nur einen Tag. Und, was sich hierorts noch immer
bewährt hat: Wir haben ja sehr
viel Zeit!
Erst einmal müssen wir wissen, wohin die Reise geht. Wir brauchen Prioritäten. Und wir müssen uns fragen: Welche setzen wir, wo setzen wir sie, wann setzen wir sie, und warum setzen wir sie? Und warum setzen wir andere wiederum nicht? Aber Ziele müssen wir haben, auch solche, die erreichbar sind. Wir müssen uns da ernste Gedanken machen in der Richtung. Nur Ankündigungen sollten wir meiden.
Zwischenruf
Was sagen Sie? — Also, das ist wohl nicht der Raum und Rahmen, nicht der Ort und die Stunde, um das, was schwierig genug zu betrachten ist, jetzt und hier detailliert aufzulisten. Ich bin gewiss keiner, der um die Dinge herumredet. Aber auch keiner, der aus der Hüfte heraus schießt Vieles ist da ja überhaupt noch nicht spruchreif. Und ich finde außerdem, dass man sich nicht gerade an diesem Thema profilieren sollte. Gerade hier sind wir doch aufgerufen, über Gruppengrenzen hinweg zusammenzuwirken, so wie wir das seit Jahr und Tag zum Wohl unserer Menschen immer zu praktizieren wussten — da bin ich übrigens meinem Vis-à-vis von der wichtigen Liste vom Ufer in Erinnerung an gemeinsames Fahren und Feiern zu besonderem Dank verpflichtet.
Nun, das wissen Sie, und das wissen unsere Menschen, um deren Wohl es ja zuvorderst geht. Wir werden da gemeinsam vieles vorantreiben, doch manches auch bremsen müssen, das ist keine Frage. Wir müssen die Chancen, doch auch die Gefahren sehen. Wir werden voraus‑, aber auch zurücksehen und dabei vieles bedenken müssen. Ich sehe da auch kein Allheilmittel. Aber es ist klar …
Zwischenfrage
Sehr gut, sehr einverstanden. Aber was wir nicht brauchen, das sind grobe Fragen auf nuancierte Antworten. Was wir nicht brauchen, das sind Radikale und Phantasten. Vorstellungen aus der Mottenkiste überlebter Utopien verderben da nur den Brei, wie ja auch mein Kollege im Amt des Landrats zu sagen pflegt. Was wir gar nicht brauchen, das sind ideologische Wechselbäder und kommunale Destabilisierung. Das wollen auch unsere Menschen nicht. Nein, da müssen wir uns hüten, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Da sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Bei der Gelegenheit begrüße ich auch in Ihrer aller Namen herzlich unseren Herrn Pfarrer.
Das ist doch der große Unterschied zwischen den konstruktiven Kolleginnen und Kollegen im Rat hier einerseits und den ewigen Nörglern dort neuerdings in der zugezogenen Bevölkerung: Wir durchdenken die Dinge, wir nehmen uns Zeit, und wir bringen uns — ääh sie — in Erscheinung. Und andere, die reden immer bloß und fordern und malen Utopien an die Wand. Das habe ich ja auch den Sportvereinen, der Reservistenkameradschaft und den Trachtengruppen schon erklärt, denen ich gerade bei dieser Gelegenheit mit Nachdruck einmal Dank sagen will. Man darf die Dinge einfach nicht so summarisch, nicht so plakativ, so endgültig sehen. Man muß das erst differenzieren — und dann festhalten, was wir wirklich brauchen. Aber das wollen manche eben nicht.
Zwischenruf
Jawohl! Wir brauchen Maß und Mitte. Unsere Menschen erwarten ein moralisches Fundament, gute Gesinnung und Gesittung. Wir brauchen eine blühende Gemeindestruktur, ein echtes Wachstum, damit am Ufer die Früchte reifen, die wir gemeinsam gesät haben. Wir müssen in Neuland vorstoßen und dabei jede Lücke — ääh Chance — nutzen. Wir brauchen sicherlich auch Investitionen, aber mit heimatlicher, am Brauch orientierter Komponente. Auch diese Komponente muss immer wieder auf den Prüfstand, muss ständig überprüft werden, sehr genau.
Jeder muss den Rahmen sehen. Und dennoch betone ich: Wir haben Leuchttürme geschaffen, die weit ausstrahlen, darüber sollte wirklich kein Streit toben.
Wir brauchen natürlich auch die Stimme der Religion, brauchen — das sage ich bewusst als Amtsträger für alle — die Autorität der Kirche. Wir brauchen eine Politik von Menschen für Menschen, ein soziales Miteinander, gebaut auf Tradition, Brauchtum, Nachbarschaftlichkeit. Lassen Sie uns über den Tellerrand hinausblicken und einen runden Tisch des Maßes und der Vernunft bilden — für unsere Bürger.
Der Stil des Menschen ist es, der den Staat macht, wie uns der heilige Augustinus sagt. Lesen Sie nach, und Sie werden begreifen, dass Politik die Kunst des Möglichen im weitesten Sinn ist, aber kein Feld für Leute, die ständig Segel setzen müssen, kein Selbstbedienungsladen und kein Platz für Geschwätz. Politik heißt Erahnenkönnen der Zukunft. Dazu brauchen wir Menschen, die nicht in der, zugegeben schmerzlichen Geschichte rühren, sondern flexibel und innovativ sind, aber eben auch dienen können.
Zwischenruf
Ja, das ist die Stimme der Obstruktion, das nützt niemandem. Aber bitte: Ich habe auch keine Patentrezepte. Ich bringe Denkansätze. Aber wir dürfen nicht verkrampft an die Dinge herangehen. Einer lebt in dieser schönen Großgemeinde vom anderen. Und, das darf ich im Namen aller sagen, der Amtsträger hat eine unveräußerliche Entscheidungspflicht, die ihm schon kraft seiner Wahl durch eine Mehrheit zuwächst, Kompetenz hin, Sachkunde her.
Ein bisserl ist das ja alles auch eine Stilfrage. Darum sage ich: Zeigen wir uns den Herausforderungen gewachsen, indem wir Trennendes überwinden, uns Zeit für gemeinsames Innehalten, zur Annäherung auch im Menschlichen nehmen. Und lassen wir nicht zu, dass ein paar profilierungsbedürftige Minderheitensprecher uns mit kleinkarierten Einwänden oder maßlosen Wünschen, noch dazu öffentlich, die haushaltsmäßigen Grundlagen dafür beschneiden wollen.
Jeder weiß, ich nehme meine Fürsorgepflicht gegenüber Nutznießern gern wahr, auch in finanzieller Hinsicht. Ich finde nämlich nicht, und da bin ich mir der Zustimmung aller Kolleginnen und Kollegen sicher, dass eine im öffentlichen Interesse, im Dienste unserer Menschen geleistete Arbeit nicht des Lohnes wert wäre. Da bin ich Christ und Marktwirtschaftler in einem. Doch vor allem: Wir brauchen viel Toleranz und geistige Kraft. Darum warne ich nachdrücklich vor Reden, die nur reine Luftblasen sind.
Das wollte ich in aller Kollegialität, aber eben auch in aller Deutlichkeit und Klarheit, gesagt haben als einer, der hier und heute Verantwortung zu tragen hat und nur allseits appellieren kann: Tragen wir diese Verantwortung gemeinsam — im Interesse des Wohlseins unserer Menschen in dieser schönen Großgemeinde!
Ich danke Ihnen.
Zurufe aus
den Arbeitskreisen.
Langanhaltender Beifall bei den Unleserlichen.